|
Zur
Startseite
Wegweiser
durch meine Homepage
Mein
Maintal
Hochstadtseite
Augenblicke
Durchgeblickt
Homopolitikus
Wochenendglossen
Meine
Bücher
Vermisst
Der
Untergang Ostpreußens
Von
Gumbinnen bis Balga
Spurensuche
Hermann Lohmann
Krieg
und Werbung
Graukopfsatiren
Pflegedrama
"Zuerst komme ich"
Das
Bauernopfer
Mein
Ruhestand
Mein
Garten
Meine
Modellautos
Kabarett
Mikrokosmos
Sonstiges
Irland
Die
Lupe
Was
ist Humor?
Zeitgeist
Heeresfliegerseite
Impressum
| |
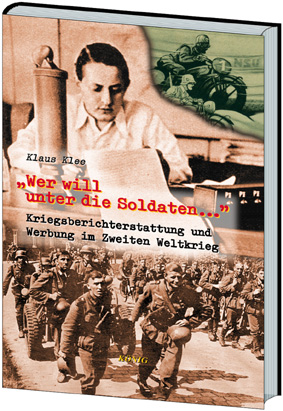 |
|
Die
folgende Dokumentation baut auf den Heften

der
Jahre 1937 bis 1944 auf und befasst sich mit dem Wechselspiel
von Kriegsberichterstattung, dem
Strategiespiel "WEHR-SCHACH" und der Werbung,
was zusammen genommen aus der Kriegsberichterstattung
eine teilweise
unterhaltsame Lektüre machte, die auf eine groteske Weise
das Grauen des Krieges mit der
Normalität in der Heimat miteinander verband.
Die
Dokumentation ist in wesentlich erweiterter Form ab
dem Jahresende 2011 vom KÖNIG-Verlag auch als Buch
erhältlich unter
ISBN 978-3-943210-00-2 |
|
|
|
Ehe
Sie die folgende Seite lesen, möchte ich Ihnen einige Hinweise
geben. Alle Texte, die hellblau gekennzeichnet sind, sind
Erläuterungen und Kommentare, die aus heutiger Sicht zum besseren
Verstehen, aber auch der Kritik dienen. Alle anderen Bestandteile
dieser Seite sind im Original den WEHRMACHTs-Heften entnommen.
Die
gewählte - nicht chronologische Reihenfolge - soll in einem bunten
Mix von Angriffen, Rückzügen, Gegenoffensiven, rasanten
Absetzbewegungen und Fluchten jeden Eindruck der anhaltenden
Dominanz aller Parteien auf den Schlachtfeldern relativieren. Es wurde darauf
geachtet, dass die ausgewählten Originaltexte von Kriegsberichterstattern
stammen, die mit Pathos und Propaganda sparsam umgingen. Dennoch ist
immer wieder zu spüren, dass diese Elemente verstärkt benutzt
wurden, um auch in der Heimat den Durchhaltewillen zu stärken. Die
kämpfende Truppe sollte der Zivilbevölkerung ein Beispiel geben.
Es ist dabei leicht zu erahnen, was die Frontsoldaten über die
Inhalte dieser Schriftenreihe dachten. Viele von Ihnen kehrten nie
zurück, weshalb man sie nicht mehr befragen kann. |
 |
An
alle Militaria-Sucher im Raum Königsberg:
Gefundene
Erkennungsmarken bitte melden! Die Telefonnummer des Leiters der
Gefallenensucher vom Volksbund lautet
+7
906 2302651 So
können noch Schicksale geklärt werden !
Поисковики
из
Кёнигсберга,
сообщайте
пожалуйста
о своих
находках -
опознавательные
жетоны со
всех
солдат. До
сих пор
тысячи
числятся
пропавшими
без вести! +7
906 2302651 |
|
Einleitung
Alle
Leser, die auf dieser Seite eine Verherrlichung des Krieges und des
Nationalsozialismus vermuten und gar nicht erst weiterlesen wollen, kann ich beruhigen.
Es handelt sich um eine Seite, die im Zusammenhang mit meiner Dokumentation "VERMISST
- das kurze Leben des Soldaten Walter Michel" entstand. Auf der
Suche nach authentischem Bildmaterial und Information stieß ich auf die
Publikationen des Oberkommandos der Wehrmacht, die von einem bestimmten
Personenkreis abonniert wurden. Darin ist eine höllische Mixtur von
Bildberichten, Kampfberichten, Propaganda, Werbung und Unterhaltung, die dem
Leser vermittelt, dass der Faktor Mensch auf Statistenrollen reduziert war. Die Menschen
wurden von den Generalstäben und nicht zuletzt von der obersten Führung und Heeresleitung rücksichtslos für wahnwitzige Ziele geopfert.
Für die
Kriegsgewinnler, die Parteibonzen, die Militärs in der Etappe, Schreibtischtäter, die Justiz und der Personenkreis, der es verstand, niemals in die Nähe
der Gefahr um Leib und Leben zu kommen, waren die Hefte nicht mehr als eine unterhaltsame
Lektüre. Sie waren so alltäglich, dass man darin ungeniert werben konnte als
lebte man im tiefsten Frieden. Eigentlich erinnert das doch sehr an die
heutige Fernsehwerbung, in der Dokumentarisches, Sport und Nachrichten mit
Werbung kombiniert wird. Man könnte meinen, die Macher seien damals schon
ihrer Zeit voraus gewesen.
Einige
Kriegsjahre war es daheim "im Reich" noch völlig normal und das
Leben ging ungetrübt weiter. Allenthalben die eintreffenden Meldungen
über Gefallene rückte den Krieg ins Bewusstsein. Das änderte sich, als die Alliierten die
deutschen Städte bombardierten und das Leben in den Trümmern
unerträglich wurde. Jetzt stellte sich auch hier Betroffenheit ein. Frontsoldaten auf Heimaturlaub, die eine
Bombennacht in einer der Großstädte erlebten, fühlten sich in ihrem
Frontabschnitt sicherer und sprachen davon, wieder "heim" zu
fahren - in ihren Abschnitt an einer der Fronten in Norwegen, Finnland,
den baltischen Staaten, Russland, dem Balkan, Italien, Frankreich oder in
Nordafrika.
Hinter
der gigantischen Militärmaschinerie stand dass Kapital, die Rüstungsindustrie,
die
Produktion von Lebensmitteln und von kriegswichtiger Ausrüstung sowie eine ungeheuere Logistik. Was alleine die Reichsbahn logistisch leistete, ist
unglaublich. Eisenbahnpioniere der Wehrmacht stellten europaweit sicher, dass die Züge
auch in den entlegendsten Gegenden nach schwerstem Beschuss oder nach
Sabotageakten wieder
rollten. Ohne Nachschub wären Millionen Soldaten mehr dem Untergang
preisgegeben gewesen. Dort, wo das nicht mehr gewährleistet war, wie in
den Kesseln von Stalingrad, in Ostpreußen und anderen Kesseln, musste die Luftwaffe die
Versorgung übernehmen. In Stalingrad versorgten sich die Frontkämpfer
teilweise bei ihren getöteten Opfern mit deren Einsatzrationen, weil der
Nachschub zum Erliegen kam. Auch Winterkleidung wie Mützen, Stiefel und
Schutzkleidung wurde beim Gegner requiriert, weil
man eigentlich noch vor dem ersten Winter gewonnen haben wollte. Daraus
wurden aber drei Winter, wie sie selten einer erlebte.
Wer
verwundet war, konnte aus Mangel an medizinischer Versorgung und bei
unglaublich unhygienischen Bedingungen kaum auf Rettung hoffen. Zu
Tausenden siechten sie in Kellergewölben umkämpfter Städte umgeben von
Fäulnis, Fäkalien und Tod dahin, bis sie nicht selten unter höllischen
Qualen von einem gegnerischen Flammenwerfer erlöst wurden. Auch der
Gegner hatte teilweise keine Kapazitäten, um sich der Opfer anzunehmen.
Wo die Linien zerschnitten waren, gab es kaum Hoffnung auf Entsatz, wenn
die oberste Heeresleitung das "Durchhalten bis zur letzten
Patrone" befohlen hatte.
Mein
Schwiegervater, der den gesamten Russlandfeldzug miterlebte, sprach immer
vom Ausschlachten noch zappelnder schwerverletzter Pferde, ehe sie bei
minus 40 Grad Frost innerhalb kürzester Zeit zu einem Eisklumpen
zusammengefroren waren. Alkohol war übrigens generell die Beute der einfachen
Soldaten, die ohne den Alkohol so manche Übermacht schon rein mental gar nicht verkraftet hätten. Ordnung und Sauberkeit waren einer
Ungezieferplage und mangelnder körperlicher Hygiene gewichen, weil es an
allem fehlte und man immer seltener die Zeit hatte, geräumige
Unterstände auszubauen, in denen ein halbwegs normales Leben möglich
gewesen wäre. Das Leben in Löchern und Gräben, in zerfallenen Häusern
und Heuschobern war zum Alltag geworden, als es nur noch zurück ging.
Kaum jemand zehrte noch von den Offensiven zu Kampfbeginn, als es an
nichts mangelte. Schon aus diesem Grund ist das Werben um typische
Konsumgüter der Friedenszeit in diesen Heften so grotesk. Es soll
Normalität vortäuschen, wo der Mangel bei der normalen Bevölkerung
Regie führte. Allenthalben in ländlichen Gebieten war der Mangel noch
nicht angekommen. Absolut kurios war, dass der Tross, Unterstützungseinheiten wie
Reparatur- und Werkstatteinheiten - die "Feldwerften" - sowie
das fliegende Personal relativ gut versorgt waren und sogar lebenswichtige
Güter nach Hause schickten, die sie zuvor in der Marketenderei erworben
hatten. Der Wehrsold konnte praktisch für andere Dinge gar nicht
ausgegeben werden. Bei der Marine galten andere Gesetze und die
Verpflegung ließ nichts zu wünschen übrig. Heimaturlaube waren für
viele Frontsoldaten die Einzige Möglichkeit, einmal
relative Normalität zu erleben, wenn man das Glück hatte, in einer
friedlichen Gegend zuhause zu sein.
Wenn
man sich nun die eingangs erwähnte Bevölkerungsschicht ansieht, die es
verstand, den Unannehmlichkeiten der Zeit weitestgehend aus dem Weg zu
gehen und das eigentliche Geschehen nur aus diesen Heften, den Nachrichten
und den
Wochenschauen kannte, dann kann man förmlich das reale Spiel mit TAKTIK
und der Macht spüren, das sich im WEHR-SCHACH, einer wesentlich
variantenreicheren Abart des normalen Schach, spielerisch austobte. Alle
einzunehmenden Position mussten doppelt bedroht sein, wodurch das
Zusammenspiel von Infanterie, Panzern, Artillerie und Luftwaffe zur
doppelstrategischen Herausforderung wurde und sich regelrechte Frontlinien
ergaben, die es zu halten gab. Das war etwas für Menschen, die gern
miterleben, wie man von Sieg zu Sieg eilt. Ob in den Jahren 1944 und 1945
noch WEHR-SCHACH gespielt wurde, ist nicht bekannt.
Wer
dennoch Lust verspürte und durch die Hefte "Die Wehrmacht" animiert war, konnte das Grauen
der Schlachtfelder in den eigenen vier Wänden mit dem WEHR- SCHACH-Spiel
auf martialische Art nachempfinden.
|
 |
|
In
den Heften bis Ende 1943 finden sich immer wieder Schach-Ecken, in denen
über strategische Spielzüge gefachsimpelt wurde. Die Erläuterungen
waren stets von martialisch klingenden Lageberichten begleitet, die eine
Nähe zur Realität erzeugen sollten. Ob
es galt, die diagonal verlaufende Heerstraße oder den in anderer
Diagonale verlaufenden Fluss zu schützen oder zu beherrschen, ob es darum
ging, die Seenfelder in die Strategie einzubinden - es tobte eine
gewaltige Schlacht, bei der die Einheiten nach Belieben zugunsten eines
höheren Zieles geopfert werden konnten, ohne dass man dabei
Gewissensbisse haben musste. Wahrscheinlich ahnte kaum jemand, dass es an
den Frontabschnitten der Wehrmacht ähnlich skrupellos zuging und sehr oft
Menschen gleichen Schlages die Befehle gaben. Dieses Schachspiel kann als
Vorläufer heutiger Games gelten, die den Spieler auf ähnliche Art zum
vermeintlichen Herren über Leben und Tod machen - wie beim WEHR-SCHACH. Blutiger
Ernst und die Unausweichlichkeit vieler Schicksale auf der einen Seite und
das unterhaltsame und risikolose Schachspiel in der warmen Stube sind
Gegensätze, die nur eine Zeit mit besonderem Gedankengut schaffen kann. |
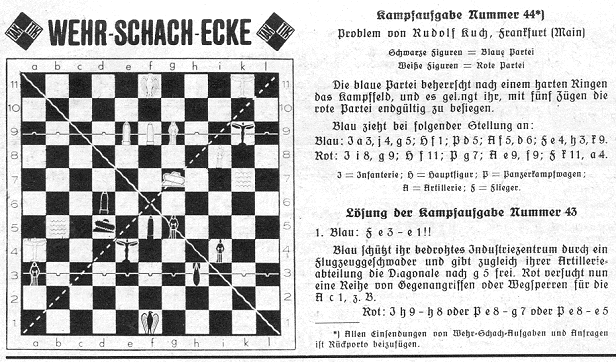 |

 |
|
Kriegsberichterstattung
und Werbung
Sie
haben es bereits bemerkt, wir sind beim Thema Werbung der
Schriftenreihe "Die Wehrmacht" angekommen. Hier habe ich
eine Auswahl von Werbungen zusammengestellt, die zeigt, wer die Kriegsgewinnler waren, die bis zum heutigen Tag munter ihre Produkte
vertreiben, die im technischen Bereich vielfach erst durch den Krieg reiften und ohne
den
sie wohl kaum die
weltweite Bedeutung erlangt hätten. Es ist allerdings auch interessant, dass der
größte Lieferant der Wehrmacht - der KRUPP-Konzern - kaum
werbetechnisch in Erscheinung
tritt, es sei denn, durch die Werbung einiger kleiner Töchter.
Erfolg
ist eine gute Reklame
Die
Firmen verbanden die Leistungsfähigkeit ihrer Produkte mit dem Erfolg und den
sensationellen Siegen der Wehrmacht, der Luftwaffe und der Marine und
empfahlen sich damit auch befreundeten Nationen. Große Verluste militärischer Ausrüstung und der
massenhafte Einsatz von Munition, Bomben und Granaten dürfte bei den
Firmeninhabern wegen der angerichteten Schäden nicht zur Depression geführt haben, denn mit jedem
"Materialverbrauch" wurden sie reicher und reicher. Sie profitierten
so auch direkt von den
Beutezügen der Armeen, die dann auf einem kleinen Umweg mit klingender Münze in ihren Kassen
landeten. Die Menschen, die bei Flugzeugabstürzen, Schiffsversenkungen,
in zerstörten Panzern, zerstörten Artilleriebatterien, verlorenen Nachschubeinheiten und mit Handwaffen kämpfend ihr Leben ließen, waren
für sie immer nur Begleiterscheinungen, die zum Geschäft gehörten. Das
hat sich bis zum heutigen Tag nicht geändert. In den USA finanzieren die
großen Rüstungskonzerne und die Petrochemie sogar die Wahlkämpfe, um auf besonders
demokratischem Weg die "richtigen" Präsidenten ins Amt zu
hieven. Krieg kennt keine Moral, wenn es darum geht, Rohstoffquellen in
Besitz zu nehmen, Absatzmärkte zu erschließen und nebenbei
Rüstungsgüter an den Mann zu bringen. Spötter behaupten
sogar, der erste Irak-Krieg sei nur deshalb geführt worden, weil die
vielen vorrätigen computergesteuerten Waffen vor dem Jahrtausendwechsel
verbraucht werden mussten, weil man sich der Programmierungen nicht sicher
war. Entsorgen war lukrativer als das Umrüsten! Der Tod von einer halben
Million Menschen wurde anscheinend billigend in Kauf genommen. Jede
Wahrheit zu seiner Zeit!
Erst
der Mensch bringt den Tod
Was
mich erreg, ist die Art, wie Berichte über Tod und
Verderben, Bildmaterial und die Werbung kombiniert wurden. Der Mensch war
damals in
höchstem Maß und unfreiwillig von den beworbenen Produkten abhängig, die für ihn
allerdings ohne den Krieg völlig bedeutungslos gewesen wären. Der Tod, der auf
Qualitätskugellagern, Motoren der Spitzenklasse und Superkanonen daher kommt und mit
exzellenter Optik versteht, Geschosse ins Ziel zu lenken, wird
kurzerhand ausgeblendet und auf die Fotos Besiegter reduziert, weil sie
angeblich Opfer ihrer mangelhaften Ausrüstung und Fehlern ihrer
Heeresleitung geworden waren. Man stellte einige Maschinengewehre mit
ausreichender Munition Tausenden von toten Soldaten gegenüber, die beim
sinnlosen Anrennen von Stellungen im Kugelhagel fielen und gab zu
verstehen, dass dies nur infolge der hohen Qualität der Waffen möglich
sei. Tragisch ist nur,
dass erst der Mensch mit Hilfe der Ausrüstung den Tod bringt, der ihn
später allerdings ebenfalls ereilt, wenn ihn sein kriegerisches Gerät im Stich
lässt oder der Nachschub versiegt. Man ließ auch gern wissen, dass
deutsches Gerät niemals total zerstört sein kann. Was der kämpfende Soldat
"verbrauchte", wurde oft immer
wieder vor Ort von einem Heer von Instandsetzern kampftauglich gemacht.
Triebfeder war die Angst des einfachen Soldaten vor dem Untergang. Nur mit
technischem Geschick und Improvisation war man der gegnerischen Übermacht
überhaupt gewachsen. Und selbst daran verdiente die Rüstungsindustrie
noch gewaltig mit
ihren Ersatzteilen.
Lassen Sie die Kombination des authentischen Materials auf sich
wirken - Sie werden vielleicht bald ein Unbehagen spüren, das sich auch bei mir
einstellte.
|
|
Die
Wehrmacht eilte zu Beginn des Krieges von Sieg zu Sieg und die Straßen
der Ortschaften waren generell von rauchenden Trümmern gesäumt. Die auf der Flucht geräumten
Gegenden wurden vom Feind nieder gebrannt, damit dem Gegner
weder Unterkünfte noch Lebensmittel in die Hände fielen. So kam es in
den Einheiten zu immer ungeordneteren Zuständen, was Kleidung und
Hygiene anbelangte. Die Verpflegung kam allerdings immer noch recht schnell nach, so
dass die Moral nicht absank. Wo es einmal klemmte, wusste man sich auch zu
helfen.
Unter
dem Gesichtspunkt der Daueroffensiven und der hektischen Rückzüge dürfte die
Reklame von ERDAL, die wohl mehr zum Kasernenhof und zu den
Stabsstellen gehörte, an der
Front kaum von Bedeutung gewesen sein. Dort waren Fett und andere Hilfsmittel viel wichtiger
gegen Feuchtigkeit als Hochglanz. An der Heimatfront dagegen - im
trauten Leserkreis des Heftes "Die Wehrmacht" - waren frisch
gewichste Stiefel und Operettenuniformen, wie sie manche lokale
Führungsgröße bis hinauf zum Feldmarschall trug, eher die Regel.
|
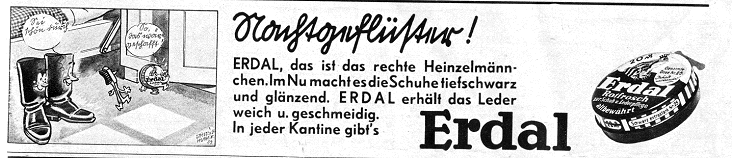
|
Von
Tommies, Spitfires und Klischees
Ein
wichtiger Abschnitt war die Blockade gegen England, um die Briten von
ihren Versorgungsquellen abzuschneiden. So entwickelte sich der Seekrieg
rund um das Königreich sehr heftig und auch entlang der Küsten waren die
Kampfhandlungen enorm. Zwischen den Luftwaffen aller Kriegsparteien
entstand ein Wettlauf um Ausrüstung und um Piloten, die gar nicht schnell
genug ausgebildet werden konnten. Mit jedem Abschuss verloren die
Kriegsparteien Piloten, was in England sehr bald zum Engpass führte. Dort
flogen jedoch auch Franzosen, Polen und andere Nationalitäten. Später
übernahmen die Amerikaner die Bombenflüge bei Tag, Es war das Bemühen
der Propaganda aller Kriegsparteien, jeweils die Gegner als minder fähig
hin- und die eigene Kampfkraft herauszustellen. Ein gutes
Beispiel ist der nachfolgende Bericht.
|

|
Wieder
stößt ein Riesenschatten auf uns zu. Seine sämtlichen Waffen speien
gegen uns - gefährliche Sprengstücke, Eisenteile und Holzsplitter spritzen auf Deck
umher. In Sekunden ist er so nahe, dass deutlich das verkrampfte
Gesicht zu erkennen ist. Unwillkürlich zieht jeder den Kopf ein;
infernalischer Donner verschluckt eine Sekunde lang das Getöse unserer
pausenlos feuernden Abwehrwaffen. Die Spitfire zieht über die Mastspitze
unseres Bootes hinweg und jetzt flattern in den in sich zusammen-
sinkenden
Wasserfontänen der rings ums Schiff einschlagenden Garben einige
handtellergroße Fetzen ins Wasser. Es sind ausgekohlte Elektron-
blechteile
- Hautfetzen von der Spitfire, die unsere Kanone herausriß. |
Unser
Kommandant erteilt Feuer- erlaubnis |
Hurra
- er brennt! Führerlos rast die schwer getroffene feindliche Maschine
über den Wasserspiegel und verschwindet dann unter haushoher Wassergischt
im Meer. Rechts im Hintergrund eines der Boote, das sich mit seiner Kanone
zweier Spitfires zu erwehren versucht. Die Geschossgarben der beiden
feindlichen Angreifer liegen schon hart am Schiff. Ganz im Hintergrund die
schwere Rauchfahne eines senkrecht ins Meer stürzenden Engländers.
|
Ich
möchte diese Geschichte gar nicht anzweifeln, obwohl es recht
unwahrscheinlich ist, dass es dabei auf deutscher Seite ohne Verluste
abging. Im Verlauf des Krieges bewiesen aber die Flieger, dass sie
mit einer bestimmten Taktik, bei der Bomben und Torpedos zum Einsatz
kamen, dass Schiffe für sie eine leichte Beute waren. Das mussten
auch unsere U-Boote schmerzlich erfahren, die zu Kriegsende
reihenweise auf diese Art versenkt
wurden.
|
|
Der
NSKK-Kriegsberichterstatter Theo Matejko und sein Kamerad,
NSKK-Kriegsberichter Fritz Kämmel, befanden sich an Bord eines
der Boote einer kleinen Flottille, die am 27. Mai 1942 nachmittags an der
holländischen Küste von 37 Spitfires im Tiefflug angegriffen wurde.
Unmittelbar nach diesem Erlebnis machte Matejko die obigen Zeichnungen und
Kämmel schrieb dazu:
Es
ist am zeitigen Nachmittag. Das Führerboot der kleinen Flottille, auf dem wir
uns befinden, ist auf Positionskontrollfahrt, begleitet von einem anderen
Fahrzeug der Flottille. Wir treffen Boot X, welches herüberblinkt, dass es eine
treibende englische Ankertaumine entdeckt hat, die es unschädlich machen wird.
Wir gehen auf die Kommandobrücke und kurze Zeit darauf sehen wir ein phantastisches Bild: ein Riesenqualmpilz von mehreren hundert Metern Höhe steigt
aus der gesprengten Mine empor! Ganz langsam verweht der Rauch im blauen,
sonnenklaren Himmel.
Da
stoßen aus dem Wolkenkranz des Horizontes - geradewegs auf uns zu - zehn
Spitfire-Maschinen. In Bruchteilen von Sekunden sind sie auch schon greifbar
nahe und schießen aus allen Rohren. Aber in noch kürzerer Zeit - man kann eine
Zeitspanne nur sehr schwer mit Worten beschreiben - sind alle drei Boote der
Flottille gefechtsklar und abwehrbereit. Ja, im gleichen Moment, als die erste
Spitfire-Garbe 50 Meter entfernt ins Wasser schlägt, haben sämtliche
Abwehrwaffen bereits Feuerbefehl und die ersten Angreifer, die einen solchen
Feuerempfang keineswegs erwartet haben, drehen schleunigst ab.
Die
zweite Welle der Spitfires aber greift noch tiefer mit verbissener Zähigkeit
an. Rings um das Boot können wir die Einschläge beobachten, aber auch schon
eine bedenkliche Zielgenauigkeit! Der Feind hat sich auf unsere drei Boote
konzentriert und erst jetzt können wir die Einsatzstärke der Engländer
abzählen. Es sind 37 Spitfires, von denen jede einzelne je drei Angriffe auf
eines der Boote macht! Der Kampf entwickelt sich auf beiden Seiten zäh und
erbittert - es ist ein Kampf mit ungleichen Waffen, denn eine Spitfire hat 8
Rohre an Bord. In rücksichtslosem Einsatz kämpft die Mannschaft des
Kommandobootes vom Smutje bis zum Kommandanten und jeder Angriff wird mit
großem Geschick abgewehrt. Zeit hat keiner mehr, um sich um das Schicksal der
beiden anderen Boote zu kümmern - wir wissen nur, dass sie genau wie unser Boot
in schwerstem Feuer liegen.
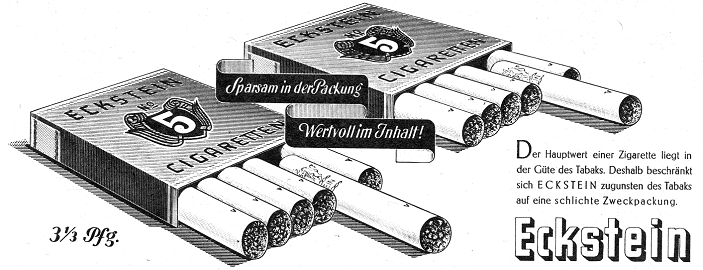
 |
Sprengstücke,
Eisenteile und Holzsplitter spritzen auf unserem Deck umher und oft stehen die
feindlichen Einschläge in Fontänen wie die Spitzen eines Gartenzaunes um das
Boot. In immer neuen Wellen greift der Feind unter Ausnutzung aller Vorteile an.
Oft richtet das Boot sämtliche Rohre auf den am nächsten liegenden Briten,
während bereits von der entgegengesetzten Seite eine neue Spitfire heranfliegt.
Schon stößt ein Riesenschatten geradewegs auf unseren Schornstein zu. Man kann
den Piloten in der Maschine sitzen sehen. Seine sämtlichen Waffen speien Feuer
gegen uns - aber noch zu kurz. Zwei MG-Schützen sind in seine Richtung geschwenkt und in eine Garbe von Leuchtspurmunition gehüllt fliegt er plötzlich
unsicher schwankend landeinwärts. Starke Rauchentwicklung zeigt, dass er
brennt. Er erreicht das Ufer nicht mehr, sondern stürzt eine Meile entfernt
berennend ins Wasser, wo er sekundenschnell verschwindet. Indessen hat die Flak
im Vorderteil des Schiffes bereits den nächsten Gegner im Visier. Auch dieser
ergreift stark qualmend die Flucht und verschwindet - sich noch überschlagend -
im
Meer.
Da
kommt in Riesengeschwindigkeit über einem unserer Boote in hundert Meter Höhe
ein Angreifer heran. Vom Boot aus schlagen aber schon die Leuchtgarben direkt in
seinen Rumpf und brennend zerschellt auch diese Maschine auf dem Wasserspiegel
und versinkt. Ganz plötzlich ist um unser Boot Ruhe, fast unheimlich kommt uns
das nach diesem Kampflärm vor. Nur die Stimme des Flottillenchefs, die man
während des Geschützdonners kaum hören konnte, kommt jetzt wie aus großer
Ferne, obgleich er direkt neben mir steht: "Feuerschutz achtern für Boot X!"
Mit voller Kraft dreht das Boot und schießt jetzt aus allen verfügbaren Rohren
auf den hartnäckigsten aller Angreifer, der dieses Boot aus 30 bis 40 Metern
Höhe bestreicht, aber vor dem plötzlichen Feuerangriff des Kommandobootes
schleunigst die Flucht ergreift.
Auch
das dritte Boot hat sich tapfer und hartnäckig verteidigt. Auf Winkanfrage, ob
es Hilfe braucht, antwortet es nur: "Zwei Abschüsse, Herr
Kommandant!" Der Himmel ist blau wie zuvor. Alle noch übrigen Angreifer
sind westwärts verschwunden. 15 Minuten hat das ganze Gefecht gedauert - bei
schwerem Seegang haben sich drei Vorpostenboote gegenüber einem Rieseneinsatz
von Spitfires ganz allein verteidigt: fünf bestätigte Abschüsse und mehrere
Trefferschäden - und wer weiß noch, wie viele von den geflohenen 32 nach
Passieren des deutschen Küstenflakgürtels, verfolgt von deutschen Jägern,
noch übrig geblieben sind.
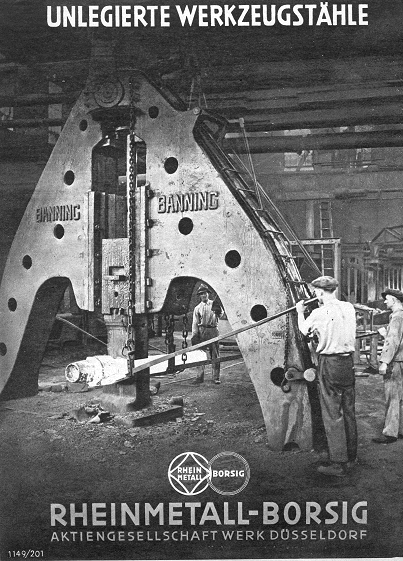
|
|
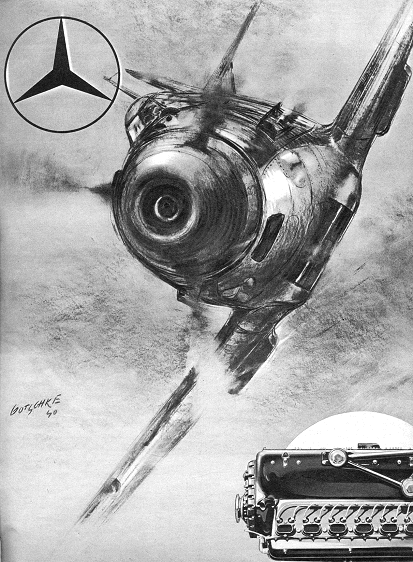 |
|
An
der russischen Front
Im
Januar 1943 wüteten die Abwehrkämpfe gegen die Rote Armee, die zur
Gegenoffensive angetreten war. Die Zeit der schnellen Erfolge hatte einen
gewaltigen Dämpfer bekommen. Das Leben der Soldaten in den Frontlinien
bestand aus fortwährendem Buddeln von Löchern und Gräben, damit man ein
wenig geschützt war. Der Tod lauerte überall und selbst die menschlichen
Verrichtungen wurden zum lebensgefährlichen Gang. Dreck, Feuchtigkeit,
Kälte, Hunger und die Müdigkeit forderten von den Männern Tribut. Wer
verletzt war, musste aushalten, bis es eine Gelegenheit gab, sich in
Sicherheit zu bringen. Schwerverwundete konnten infolge des fortwährenden
Beschusses oft nur in den Nachtstunden in ihre Gräben zurück geholt
werden. Ihre Rufe und Schreie zermürbten die Kameraden zusätzlich. Die
Situationen forderten den Männern alles ab und die Sinnlosigkeit des
Krieges wurde tagtäglich greifbarer.
Mit dem Rückzug kam man aber auch der Heimat
wieder etwas näher, was zur Freisetzung neuer Kräfte führte,
denn kein Soldat wollte sich ernsthaft vorstellen, was in der Heimat und
einem selbst passieren würde, wenn man den Gegner nicht aufhielt. Dazu hatte
man allzu deutlich miterlebt, was man selbst auf dem Vormarsch in den
besetzten Gebieten anstellte und dass man auf dem Rückzug nur verbrannte
Erde zurück ließ. Manche Einheit hatte auch Massenmord und Gräueltaten
miterlebt oder gar flankiert, worüber sie aber aus gutem
Grund und in ihrer Situation schwiegen. Im nachfolgenden Bericht schwingt zwar erhebliches Pathos
mit, aber die Einsamkeit jedes Einzelnen während und nach einer Schlacht
ist ganz gut getroffen.
Eigentlich ging es vorrangig
jedem nur darum, die eigene
Haut und die der Kameraden zu retten, ohne die man selbst ein Nichts war.
Mit zunehmender Kriegsdauer veränderte sich das aber. Gegen Kriegsende kam kaum mehr
neue Kameradschaft auf, weil die jungen
Soldaten, mit denen man die Einheiten auffrischte, oft nur eine
Lebenserwartung von wenigen Wochen hatten. Es waren vornehmlich die
ausgebufften "Frontschweine", die sich Dank ihrer großen
Erfahrung behaupten konnten und unter denen die Kameradschaft groß war..
|

Von
Kriegsberichterstatter Hermann und Sepp Jäger im Januar 1943
Immer
und zu jeder Zeit der Geschichte ist es die größere Bereitschaft des deutschen
Soldaten gewesen, die ihn alle Schwierigkeiten überwinden ließ. Mag der
sowjetische Gegner mit der ganzen Wucht seiner schier unerschöpflichen Reserven
an Menschen und Material gegen die deutschen Linien anrennen, er wird stets auf
eine Schar Verschworener stoßen, deren Herzen und Hirne im Schmelztiegel der
Schlacht mit einem unverletzlichen stählernen Willen verschweißt wurden.
Nirgends offenbart sich stärker der Triumph des Geistes über die Materie als
in den schweren Abwehrschlachten des Ostens. Wer aber oftmals unter dem
Feuerkegel der Front stand, dem zeichnet das Erlebte tiefe Runen in das Antlitz,
die zu lesen und zu deuten die Bilder dieser Seite versuchen wollen.
Wie
winzig wurde beim Anrollen der stählernen Sowjetpanzer das eigene Ich, wie
bedeutungslos das Alltägliche. Schon oft in den vergangenen Wochen tat sich in
gewaltiger Größe vor ihnen das Erkennen auf, dass es wieder einmal um Sein
oder Nichtsein des Regiments, der Armee, letztendlich des ganzes Volkes ging. Es
gab ihnen die Kraft des Aushaltens in jedem Falle.
Schweigend
gehorchen Hunderttausende dem Befehl. Die entfesselten eisigen Elemente und der
brutale stumpfe Vernichtungswillen des sowjetischen Gegners dessen Massen aus
den Eiswüsten des Ostens heranfluten, zerspellen wie Pfeile am Abwehrwillen der
deutschen Front. Die Wucht ihrer Angriffe zerschlägt sich, fällt nieder in die
weiche Tiefe der frosterstarrten Landschaft und versickert schließlich in der
unfassbaren östlichen Weite. In den Kampfpausen fallen die ermatteten Körper
der Grenadiere zwischen die schützenden Grabenwände, um aus kurzer Ruhe neue
Kraft zu schöpfen für neue Kämpfe.
Überall
da, an Fronten, wo die letzten Entscheidungen fallen, werden sie von der
unvergleichlichen deutschen Infanterie erzwungen. Auf den Gesichtern der
Grenadiere und der MG-Schützen spiegelt sich Härte und höchste Forderung
ihres Schicksals. Es sind Männer, die in den schweren Stunden der Schlacht
einen Blick in die Unendlichkeit einer anderen Welt traten, deren dunkle Tore
sich nun wieder leise vor ihnen geschlossen haben, nachdem die Schlacht
verstummte.
"Wenn
einer von uns müde wird, wacht der andere für ihn". Die Kameradschaft der
Front unterdrückt jede selbstsüchtige Regung und während noch vereinzelte
feindliche MG-Garben das verschneite Gelände abtasten, setzen sie ihr Leben
ein, um den Kameraden in den Graben zu holen, den der Tod in der Schlacht
streifte.
Im
Folgenden berichten drei Unteroffiziere von ihren Kämpfen und Erlebnissen im
eingeschlossenen Stalingrad. Es sei vermerkt, dass es sich bei diesen
Erzählungen um kleine Ausschnitte aus dem gewaltigen Geschehen von Stalingrad
selbst handelt. Die drei Soldaten waren nach mehrfachem Stellungswechsel im
Norden der Stadt eingesetzt, wo die deutschen Stellungen trotz der ungeheuren
Obermacht der Sowjets wenigstens insofern gehalten werden konnten, als es dem
Feind bis zum Abmarsch der drei Soldaten nicht gelang, die deutschen Stellungen
entscheidend zu durchbrechen. Bekanntlich richtete sich der Hauptdruck der
Sowjets in den letzten Wochen des Kampfes um Stalingrad gegen den Raum westlich
der Stadt.
Die
Berichte der drei Unteroffiziere sind so gehalten, wie
sich das bei einem Soldaten von selbst versteht, der die Wochen und Monate der Hölle von Stalingrad
hinter sich hat. Sie sprechen nicht viel von ihren Entbehrungen, und auch die
wirkliche Härte des Kampfes muss man mehr zwischen den Zeilen lesen. Die
Unteroffiziere gehören zu den Tausenden deutscher Soldaten, die im Raum von
Stalingrad und schließlich in der Stadt selbst sich in jeden Fußbreit Bodens
klammerten, obwohl jedem einzelnen bekannt war, dass es den Sowjets gelungen
war, die 6. Armee von der Hauptkampflinie abzuschneiden. Dem Leser ist bekannt,
dass die Reste der deutschen Armee Schulter an Schulter mit rumänischen Teilen
und kroatischen Verbänden mehrere sowjetische Armeen binden konnten, die
infolge der heroischen Verteidigung Stalingrads für den großen Angriff der
Sowjets an der Südfront ausfielen.
|
Klappspaten
als Nahkampfwaffe
Eine
Zwischenbemerkung sollte an dieser Stelle erlaubt sein. Auf dem
nachfolgenden Bild - einer Kampfzeichnung - ist deutlich zu erkennen, dass
im Nahkampf auch mit dem Klappspaten gekämpft wurde. Diesen hatten viele
Landser seitlich messerscharf geschliffen, so dass er mehr einer Streitaxt
glich. Mit diesen Spaten zielten sie im Kampf Mann gegen Mann zwischen
Kopf und Schulter des Gegners und hieben nicht selten bis zum Brustbein durch. Diese
Art des Nahkampfes war dem Kampf mit dem Bajonett überlegen, weil Gewehr
und Bajonett auf engstem Raum zu unhandlich waren.
|
 |
Unteroffizier
Philipp W., ein Rheinpfälzer, Inhaber des EK II, erzählt:
Ich
lag mit meiner MG-Gruppe zunächst in den deutschen Stellungen, die den
Kampfraum von Stalingrad im Norden abriegelten. Nach dem ersten schweren
Druck der Sowjets auf die Riegelstellung wurde ich mit meiner Gruppe aus
dieser Stellung herausgezogen und bis zur Stadt selbst zurückverlegt.
Hier bezogen wir vorübergehend eine neue Stellung im Nordteil der Stadt,
von dem aus wir bis zur Wolga vorstießen. Zwar belegten uns die Sowjets
immer wieder mit schwerem Feuer, aber zunächst blieb es immerhin im
Verhältnis zu den späteren Kämpfen ruhig.
Einmal
hatte ich mit meiner Gruppe ein Stoßtruppunternehmen durchzuführen. Wir
hatten eine Brücke zu nehmen und ein paar Bunker auszuheben. Unsere
Kompanie bestand zu dieser Zeit noch aus etwa 45 Mann. Das
Stoßtruppunternehmen glückte, wir hatten nicht einmal Verluste. Trotzdem
war es nicht möglich, den ungeheuren Druck der Sowjets, die nun ständig
in vielfacher Übermacht von der Flanke her angriffen, aufzufangen, und
wiederum wurde meine Gruppe zurückverlegt.
Ich
möchte hier bemerken, das unsere MGs bei den Sowjets außerordentlichen
Eindruck machten und dass, wenn die Bolschewisten angriffen, sofort alles
in Deckung ging, wenn eins unserer Gewehre zu hören war. In der neuen
Stellung bekamen wir schweres Feuer, namentlich von Artillerie und
Granatwerfern. An Eingraben war nicht zu denken, weil die Erde hart
gefroren war. Wir mussten die Stellung, die wir mit unserem Stoßtrupp
etwas vorverlegt hatten, wieder aufgeben und in unsere alte Stellung
zurückgehen, die wir richtig ausbauten; wir konnten Bunker ausheben,
Verbindungsgräben, MG- und Schützenstände anlegen usw. .
Von
den Sowjets trauten sich zunächst nur Spähtrupps an uns heran, die wir
mit Verlusten für sie abwehren konnten. Aber auch diese Stellung ließ
sich nicht halten, da unser linker Nachbar starke Verluste hatte und es
den Sowjets gelungen war, links von uns einzubrechen. Wir erfuhren dann
durch einen Aufruf des Oberbefehlshabers der 6. Armee, dass die Sowjets
die Armee von der Hauptkampflinie abgeschnitten hatten und dass wir von
allen Seiten eingeschlossen waren. Wir wussten alle, was das
bedeutete. |
|
Die
erste Maßnahme unserer Führung war, alle Rationen zu erfassen und sie
neu zu verteilen, und selbstverständlich wurden dann die Rationen
herabgesetzt. Wenige Tage später sahen wir auch westlich von uns, wo den
Sowjets die Einkesselung gelungen war, bereits die Leuchtkugeln des
Feindes aufsteigen.
Am
Weihnachtstage versuchten die Sowjets den ersten größeren Angriff auf
unsere neue Stellung, aber unsere eigene Wachsamkeit und die unserer
Nachbargruppen ließ ihre Absichten bald erkennen, und der Angriff wurde
abgewehrt. Von nun an begannen die Angriffe der Bolschewisten sich in
immer kürzer werdenden Abständen zu wiederholen. In Wellen konnte der
Feind hier nicht angreifen. Das Gelände bestand aus Häuser- und
Fabriktrümmern, und auch die Straße war von Mauerbrocken bedeckt und von
Granaten aufgewühlt. Ich zählte immer Stoßtrupps in einer Stärke von
etwa 20 bis 25 Mann, die es zunächst in der Hauptsache auf unsere
Flankengruppe abgesehen hatten. Immer wiederholten sich die Angriffe auf
diese eine Stelle; hier sollte offenbar eine Lücke geschaffen werden, in
die die Sowjets eindringen und die sie dann keilförmig verbreitern
konnten. Das Gelände, soweit man den vor uns liegenden Raum noch als
"Gelände" bezeichnen konnte, war von uns vermint worden.
Eines
Tages sehen wir mit Entsetzen, wie Zivilisten, Greise, Frauen und Kinder,
blindlings in die Minenfelder hineinliefen; später erfuhren wir den
Grund. Die Zivilisten hatten sich geweigert, über die zugefrorene Wolga
zu gehen und sich von dort aus möglicherweise nach Sibirien verschleppen
zu lassen. Aus Furcht vor der drohenden brutalen Behandlung durch die
Sowjets versuchten sie daher, den Weg zu unseren Stellungen zu finden. In
einer einzigen Nacht wurden in unserem Abschnitt etwa 500 Zivilisten
gezählt, die bei uns Rettung suchten.
Ein
andermal musste meine Nachbargruppe etwa vierhundert Meter zurück. Dem
ständig mit unverminderter Stärke und erheblicher übermacht
angreifenden Feind musste die kleine, immer schwächer werdende Gruppe
nachgeben. Rechts von uns griff der Feind mit Flammenwerfern und
Handgranaten an. Es gelang ihm, durch zu brechen und sich mit der links
durchgebrochenen Feindgruppe zu verbinden, so dass wir eingeschlossen
waren. |
 |
Ich
setzte mich über Funk mit der Abteilung in Verbindung, weil nunmehr auch meine
Stellung unhaltbar geworden war. Ein Gegenstoß wurde uns zugesagt, konnte aber
angesichts der Überlegenheit des Feindes nicht mit Erfolg durchgeführt werden,
so dass wir von der Abteilung den Befehl bekamen, die Stellung innerhalb einer
Stunde zu räumen. Wir machten uns abmarschfertig und schlugen uns einzeln nach
hinten durch. Unsere Bunker und die Geräte, die nicht mitgenommen werden
konnten, wurden gesprengt. Während wir uns durch die Häuserreste und Trümmer
durchkämpften, schossen wir ständig nach hinten, und tatsächlich gelang es
uns durch diesen Feuerzauber, die Sowjets zu täuschen: sie glaubten, es wären
eigene Leute und beschossen uns schließlich nicht mehr. Ich glaube, dass es in
der Hauptsache auf dieses Manöver zurückzuführen ist, dass wir uns ohne
Verluste durchschlugen, aber der Marsch war beschwerlich genug, denn es ging
fünfhundert Meter zwischen Häusern und Häusertrümmern bergauf.
Unser
Abschnitt, in dessen Linie wir jetzt lagen, wurde Nacht für Nacht etwa drei-
bis viermal angegriffen. Wir lagen in einer Häuserzeile, d. h. in den Ruinen
und dem Geröll einstiger Häuser. Gegenüber von uns, auf der anderen
Straßenseite, befand sich ein ehemaliges Schulgebäude, Von diesem
Schulgebäude aus unternahmen die Sowjets in der Morgen- und Abenddämmerung
ihre Angriffe. Wir hatten längst beobachtet, dass die Wodkazuteilung bei den
Sowjets ziemlich erheblich gewesen sein muss, denn an manchen Abenden hörten
wir aus dem uns gegenüberliegenden Schulgebäude Johlen und Singen, und ich
sagte dann zu meinen Leuten: "Aha, Jungens, die Russen haben wieder Schnaps
gekriegt!" Auch ein Stab muss sich in diesem Gebäude befunden haben, denn
ich konnte eines Abends in der Dämmerung einwandfrei beobachten, wie ein Mann,
offensichtlich ein Offizier oder Kommissar, mit dem Revolver in der Hand seine
Leute zu einem neuen Stoßtruppunternehmen gegen uns und gegen die
Nachbargruppen auf die Straße trieb.
Ende
Dezember war meine Kompanie noch rund fünfunddreißig Mann stark. Unsere
Stellung bestand aus kümmerlichen Erdlöchern. Ein ordentlicher Ausbau wurde
zwar versucht, aber es fehlte an Arbeitsgerät. Auch mit unserer Handgranatenmunition
mussten wir sehr sparsam umgehen, während Gewehr- und MG-Munition vorhanden
war. Unsere Ausfälle waren außerordentlich stark, und zum Schluss hatte die
Kompanie nur noch ein einziges MG. Die Sowjets lagen unserer Stellung etwa
dreißig Meter gegenüber. Sie konnten von den Ruinen und Trümmern aus, hinter
denen sie lagen, Handgranaten zu uns rüberwerfen, darunter sogar die schwere
sowjetische 1-kg-Handgranate. Hatte er bei uns ein Widerstandsnest entdeckt, und
war es nur ein Schützenstand, so wurde es sofort mit schweren Waffen, Pak,
Phosphorgranaten, Panzerbüchsen usw. bepflastert. Trotz allem wurden seine
ewigen Stoßtruppunternehmen von uns abgewehrt.
| Am 16. Januar 1943
setzte der Feind zu einem größeren Angriff an, den er mit schweren
Waffen eine Stunde lang vorbereitete. Dann kam die sowjetische Infanterie
in Massen, und zwar immer in Rudeln von zehn Mann, die sich hinter
Steinbrocken und Trümmern deckten. Mit einem MG und Karabinern gelang es
uns, die Übermacht zunächst niederzukämpfen. Plötzlich erhielten wir
Pakfeuer, und schließlich kamen auch noch zwei Panzer die Straße entlang
gefahren. Die Stellung meiner Gruppe wurde völlig zerschossen, so dass
außer mir nur noch ein einziger Mann übrig blieb. Das Kampfgetümmel war
kaum überschaubar. Zeitweise schoss der eine der beiden Sowjetpanzer in
einer Entfernung von wenigen Metern. Ich erhielt einige Granatsplitter in
das linke Schulterblatt. Mit dem einen Mann meiner Gruppe hatte ich in
unserem Gefechtsstand Deckung gesucht, der sich in einer Art Bunker unter
einem zertrümmerten Hause eingerichtet hatte.
Plötzlich stürzte ein
Mann herein und brüllte: "Panzer kommt!" Sonderlich konnte uns
diese Meldung nicht mehr aufregen. Da aber gab es eine furchtbare
Detonation mit einem Feuerstrahl, der durch den Eingang bis zu unserem
Loch hereinblitzte.
|
 |
Wir
nahmen in den Ecken Deckung, stellten jedoch bald fest, dass dei Feuerstrahl
lediglich von dem Mündungsfeuer des Panzergeschützes stammte. Ich sprang auf
die Straße bis an die nächste Ecke und stellte fest, das der feindliche Panzer
tatsächlich direkt über unseren sogenannten Bunker hinweggefahren war. Hätte
ich Handgranaten bei mir gehabt, so hätte ich den Panzer möglicherweise
erledigen können, da ich im toten Winkel stand. Jetzt hieß es, auf Infanterie
aufzupassen, die den Panzern zweifellos folgen würde. Alle sprangen aus dem
Loch heraus, und jetzt sahen wir die Sowjets tatsächlich in dichten Haufen
herankommen. Die Überlegenheit des Feindes war nicht einmal andeutungsweise zu
schätzen. Es war vollkommen klar, dass unsere Stellung nicht zu halten war. Auf
den ersten Blick konnte ich nicht einmal feststellen, was sich eigentlich
abspielte; ich konnte gerade noch einen verwundeten Soldaten packen und ihn mit
mir zurück zum Arzt nehmen.
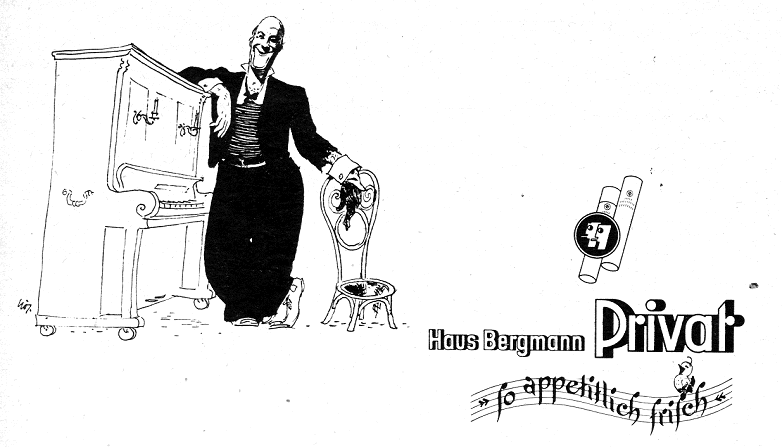
|
Wenn
Ihnen die Werbung und deren Platzierung nicht authentisch erscheint, so
ist das eine Fehleinschätzung. Ich verwende die Werbungen so, wie sie
auch in den Originalheften platziert wurde. Im Angesicht von Tod und
Verderben wirkt die Genussmittelwerbung besonders abstoßend. Aber gerade
die Rauchwaren spielten im Krieg eine große Rolle. Zusammen mit Alkohol
und dem, was von den jungen Menschen im Krieg abverlangt wurde, wurden
angeblich "Männer" gemacht, denen gar nicht bewusst war,
dass sie gerade ihre Jugend geraubt bekamen. Sich wie "Männer"
und jeder Situation gewachsen zu fühlen, war vielfach eine Illusion, die
verflog, wie der Rauch des Tabaks oder der Rauch qualmender Trümmer in
der Heimat. Sucht und Sehnsüchte sind enge Verwandte, die auch heute noch
hart beworben werden.
|
 |
Unteroffizier
Hans U., ein Oberbayer, Inhaber der beiden Eisernen Kreuze. berichtet:
Als
es uns bereits bekannt war, dass die Armee eingeschlossen war, befand ich
mich mit meiner Gruppe im nördlichsten Stadtteil Stalingrads, in den
Trümmern des Traktorenwerkes Dshershinski. Von dem Werk allerdings war
nicht mehr übrig als Mauerreste und verbogene Eisenträger. Die Sowjets
hatten bei uns noch keinen stärkeren Angriff versucht. Da kamen aber
eines Tages drei vorgeschobene Beobachter zu uns, von denen zwei verwundet
waren, und mahnten uns zur Vorsicht, denn der Feind setze zum Angriff an.
Der Zug, zu dem meine Gruppe gehörte, war zum Teil mit Männern aus dem
Tross aufgefüllt worden, für die der bevorstehende Angriff der erste
Einsatz bedeutete. Ein Schützenzug hatte vor uns zu sichern. Er
marschierte, da bisher von dem sowjetischen Druck bei uns nichts zu merken
gewesen war, ganz gemütlich vorwärts, bis plötzlich vor ihm ein
sowjetischer Offizier winkte. Im ersten Augenblick hielten die Schützen
ihn für einen Melder, dann aber erhielten sie äußerst starkes Feuer.
Ich schickte Melder zum Kompaniegefechtsstand, um den Kompanieführer
über die Lage zu informieren. Der erste Melder kam verwundet zurück, von
dem zweiten sah ich niemals etwas wieder.
Der Melder des Schützenzuges
jedoch war anscheinend durchgekommen, denn gegen Mittag wurde ein
Gegenstoß mit zwei Panzern und einem Sturmgeschütz unternommen.
Von
drei Uhr an ging der Feind zurück, und wir konnten eine Riegelstellung
besetzen. Eine Gruppe von 150 Mann hatten wir sogar eingeschlossen, die
nach Einbruch der Dämmerung unter einem furchtbaren Hurra einen Ausfall
versuchte, der jedoch trotz des Geschreis kläglich misslang. Bald danach
aber erschienen die Sowjets in Stärke von zwei Bataillonen, um unsere
Riegelstellung einzudrücken. Das Sturmgeschütz kämpfte ganz
hervorragend und jagte zum Beispiel einen sowjetischen Panzer trotz
ungünstigen Geländes über die Rüben, bis er zusammengeschossen liegen
blieb. In der gleichen Nacht wurde ich abgelöst und kam zum
Regimentsgefechtsstand, und in diesem Abschnitt blieb es einigermaßen
ruhig.
Unsere
Verpflegung war nach der Einschließung natürlich rationiert worden. Brot
war sehr knapp, und Pferdefleisch bildete unsere Hauptnahrung.
Verpflegungsbomben versorgten uns mit dem Allernötigsten und vor allem
auch mit Munition. Leider gingen viele Bomben beim Aufprall zu Bruch, da
der Boden steinhart gefroren war. |
Von
nun ab versuchte der Feind, jeden Morgen und jeden Abend in der Dämmerung
anzugreifen. Der Feind lag uns zum Teil nur zwanzig Meter gegenüber. Trotzdem
setzte er Granatwerfer, Pak und Panzerbüchsen ein. Ich brauche wohl nicht zu
erzählen, wie sich ein Kampf mit solchen Waffen auf eine so kurze Entfernung
abspielt und welche Anforderungen an unsere Männer gestellt wurden. Am 30.
Dezember wurde ich wieder in der Nähe von Spartakowka und zwar am Orlowka-Bach,
eingesetzt. Hier wurde ein Angriff erwartet, der auch tatsächlich kam, als wir
in Trümmern eines Hauses unsere notdürftige Stellung bezogen hatten.
Anscheinend hatten die Sowjets die Ablösung bemerkt. Wir lagen in schnell
ausgehobenen Erdlöchern ohne Verbindungsgräben, hinter Steinbrocken usw. Der
Angriff der Sowjets misslang diesmal, wir konnten sie in die Zange nehmen und
restlos fertig machen. Obwohl die Menge der Angreifer beim Angriff selbst schwer
übersehbar war, konnten wir nach der Abwehr an den Leichen, die sich
buchstäblich zu Bergen türmten, erkennen, wie stark die Überlegenheit des
Feindes an Menschen war, mit der wir zu kämpfen hatten. In meiner Stellung
hatte ich einen leichten Granatwerfer gefunden, mit dem ich jedoch nicht
umzugehen verstand. Eine Granate steckte noch im Rohr. Ich drehte sozusagen auf
gut Glück an der Visiereinrichtung, drückte auf den Abzug, und die Granate
brauste los. Tatsächlich hatte ich Glück, denn die Granate schlug unmittelbar
vor einem schweren sowjetischen Maschinengewehr ein. Wir konnten unsere Stellung
halten, bis ich abtransportiert wurde.
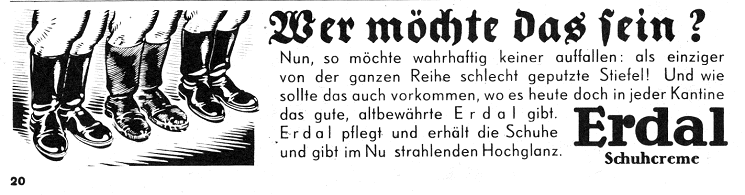
Unteroffizier
Theo G., ein Magdeburger, Inhaber des Eisernen Kreuzes II. KI., erzählt:
Anfang
November wurde ich mit meiner Gruppe in die Stadt Stalingrad verlegt, unsere
Stellung befand sich damals am Wolgaufer, wo es bis dahin einigermaßen ruhig
zugegangen war. Links von uns besaß der Feind einen kleinen Brückenkopf. Als
es den Sowjets hier Weihnachten gelang, in unserer linken Flanke durchzubrechen,
wurden wir aus der Stadt herausgezogen. Es kam Ablösung für uns, und wir
gingen sieben Tage in Ruhe. Erst am 7. Januar wurde ich wieder eingesetzt, und
zwar diesmal mehr im Norden der Stadt in der Gegend des Werkes "Roter
Oktober". Der Weg dahin war in der langgestreckten Stadt weit. Die Sowjets
wussten anscheinend gut Bescheid, dass wir beim "Roten Oktober"
abzulösen hatten. Schon in der Morgenstunde des nächsten Tages fingen sie an
zu funken. Meine Kompanie hatte sich auf die Reste von drei Häusern verteilt.
Ich lag mit meiner Gruppe in dem Backhaus einer alten Bäckerei. Bei mir hatte
ich sechs Mann und vier rumänische Soldaten, die sich im späteren Verlauf der
Kämpfe ausgezeichnet schlugen. Sehr viel war von dem Backhaus nicht mehr
übrig. Es standen gerade noch Reste der Außenmauern, und ich hatte die
Fensterlöcher zu MG- und Schützenständen ausbauen lassen.
Um
halb fünf Uhr morgens eröffnete der Feind sein Vorbereitungsfeuer. Drei
Stunden lang beharkte er uns mit allen nur denkbaren Waffen, in die
Fensterlöcher flogen Handgranaten, kurzum, es war die Hölle. Der Feind lag
etwa fünfzehn Meter vor uns. Die Gruppe links von mir befand sich sogar in
einem Haus, in dessen einem Teil sich die Sowjets eingerichtet hatten, die also
Mauer an Mauer mit meinen Kameraden lagen. Der Angriff der Sowjets war für uns
sehr unübersichtlich, da die Mauerreste, Steinbrocken Trümmer und Ruinen einen
überblick verwehrten. Mit MG, Handgranaten und Karabinern - andere Waffen
hatten wir nicht - gelang es uns, den Feind trotz allem abzuwehren und die
Stellung bis zum Abend zu halten. Was sich dann ereignete, werde ich jedoch
nicht mehr vergessen. In der Morgendämmerung nämlich deckte der Feind meine
Stellung mit einem Pakbeschuss zu, wie ich ihn überhaupt nicht für möglich
gehalten hatte. Nach einer halben Stunde war der Raum um uns völlig vernebelt,
so dass es beinahe aussah, als hätten uns die Sowjets mit Nebelgranaten
traktiert. Es war aber der Gesteinsstaub, den die aus etwa hundert Meter
Entfernung einschlagenden Pakgeschosse verursachten und der uns jede Sicht nahm.
Um diese Zeit, es mochte ungefähr halb fünf Uhr morgens sein, griffen die
Sowjets links von uns an, und zwar mit Erfolg. Ich schickte Melder zur Kompanie
und ließ berichten, dass der Feind links von uns durchgebrochen sei und nun in
unserer Flanke stünde. Bald bekomme ich den Befehl, das Haus unbedingt zu
halten.
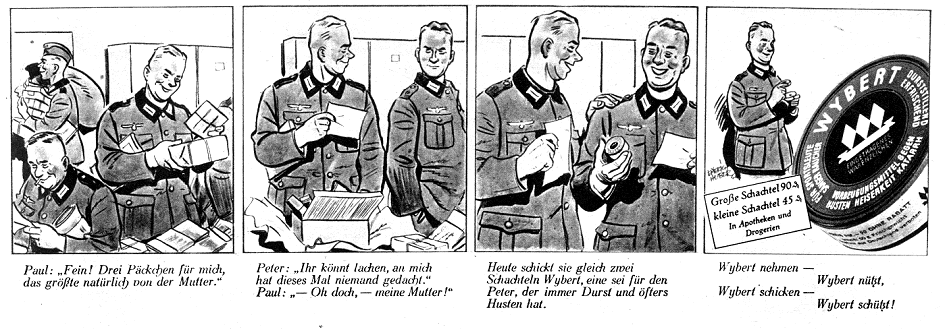
Zwei
Tage lang verteidigen wir unsere Trümmerreste gegen den ständig angreifenden
Feind. Auch bei uns wiederholt sich, was bei anderen Gruppen immer wieder zu
beobachten war oder mir erzählt wurde: Die angegriffene Truppe hatte einen
Ausfall nach dem anderen, der nicht oder nur sehr schwer ersetzt werden kann,
während die Stoßtrupps der Russen - gleichgültig, wie hoch bei jedem Angriff
die Verluste waren - immer wieder mit einer Stärke von mindestens 25 Mann die
einzelne Gruppe oder auch nur ein einzelnes MG oder einen Schützenstand
angriffen.
Nach
zwei Tagen, es war der 10. Januar, bekamen wir den Befehl, unsere Stellungen zu
räumen, um die Front zu verkürzen. Nachts rückte ich ab. Ein Pioniertrupp mit
einem Feldwebel und zwei Mann blieb zurück, um die Stellung zu sprengen.
Zunächst ging ich nur fünfzehn Meter zurück. Wir befanden uns jetzt hinter
dem Backhaus und versuchten, den Feind durch die rückwärtigen Fensterhöhlen
zu bekämpfen. Die Stellung erwies sich aber als ungünstig, zumal es den
Sowjets gelungen war, uns ein MG zu zerschießen. Wir krochen nunmehr weitere
fünfundzwanzig Meter zwischen den Ruinen der Häuser zurück. Zuletzt beschoss
uns der Feind auch aus den rückwärtigen Fensterhöhlen. Wir erwiderten das
Feuer, waren aber außerordentlich knapp mit Munition und als die letzte Patrone
verschossen war, rief ich zum Kompaniegefechtsstand hinüber, der dicht hinter
uns lag, und erhielt den Befehl: Einzeln zum Gefechtsstand zurückkommen! Mit
drei Mann, darunter einem Rumänen, langte ich beim Gefechtsstand an. Wir wurden
nun neu munitioniert und beim Gefechtsstand eingesetzt, wo wir bis zur
Dämmerung verblieben; dann wurden wir weiter zurückverlegt.
Bis
zum 12. Januar blieb es in unserer neuen Stellung ruhig, bis uns in der
Abenddämmerung des Tages der Feind dann mit Pak und schweren Waffen so gewaltig
unter Feuer nahm, dass die Luft förmlich zu beben schien. Dann erfolgte auf
unsere kleine Stellung ein Angriff in etwa Bataillonsstärke. Ich konnte mich
mit meiner Gruppe halten, aber links und rechts wurden die Kameraden
zurückgedrängt, so dass meine Stellung wie ein Brückenkopf aus unserer
Kampflinie herausragte. Als unser Kompanieführer die Gefahr für unsere Gruppe
bemerkte, bekamen wir den Befehl, mit Waffen und Munition zurückzugehen. Das
geschah in außerordentlicher Eile. Unser Kompanieführer war in diesen Minuten
durch einen Granatvolltreffer gefallen. Jeder kämpfte sich nun einzeln bis zu
einer Auffangstellung, zurück, die etwa 800 bis 1000 Meter hinter der
ursprünglichen Linie lag. Ich wurde nun mit meiner Kompanie zurückgezogen bis
zu einem Bahndamm. Hier waren die ersten feindlichen Stellungen etwa 150 bis 200
Meter entfernt; sie lagen im freien Feld, und die Sowjets wagten bis zu meinem
Abtransport keinen neuen Angriff mehr.
Zeichnung:
NSKK-Kriegsbericher Matejko
|
Ein
Kampfort von vielen
Die
große russische Offensive war in vollem Gang! Man hatte zu Kriegsbeginn
alle rüstungswichtigen Betriebe hinter den Ural zurückverlegt und der
deutschen Wehrmacht den Raum gelassen, der sich schnell erobern aber nicht
ausreichend und flächendeckend kontrollieren ließ. So sind auch die
schnellen Erfolge der deutschen Truppen zu erklären. Nachdem die Sowjets
kräftig aufgerüstet und Millionen von jungen Männern in Uniformen
gesteckt hatten, begann man an verschiedenen Frontabschnitten mit der
Offensive. So wurde in einer großen Zangenbewegung Stalingrad
eingekesselt und eine ganze Armee festgesetzt und zerrieben.
Für
die Sowjets war die Ukraine und das Donezk-Becken strategisch wichtig,
weshalb hier die Kämpfe besonders heftig tobten. Auch Weißrussland war
strategisch sehr wichtig und um Kiew herum wechselten die Städte und
Ortschaften mehrmals ihre Besitzer. Von einer dieser Gegenoffensiven
handelt der nachfolgende Beitrag.
|
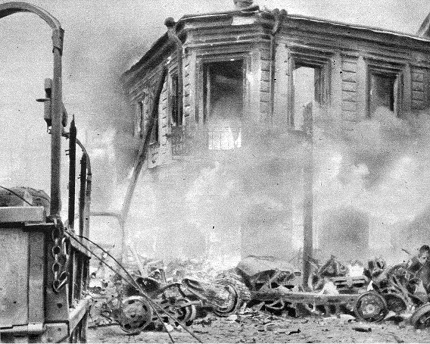 |
Brennpunkt
Shitomir
13.
bis 15.November 1943

|
Die
deutsche Widerstandskraft im Osten ist ungebrochen. Das bewiesen die
Kampftage im Raum Kiew und Shitomir. Anfang November 1943 griffen überlegene
Sowjetverbände die deutschen Stellungen in und nördlich von Kiew an. Um
einen drohenden Durchbruch zu vereiteln, wurden unsere heldenmütig und
verbissen kämpfenden Truppen auf neue, westlich gelegene Stellungen
zurück genommen. Die Sowjets versuchten mit allen Mitteln, den Durchbruch
zu erreichen.
In
der Tiefe des Einbruchsraumes wurde erbittert gekämpft. Am 13., 14. und
15. November meldet der Bericht des OKW von Kämpfen in Shitomir und
nördlich der Straße und der Zurücknahme der deutschen Truppen auf neue
Stellungen.

|
 |
 |
Schon
in den nächsten Tagen aber traten Verbände des Heeres und der Waffen-SS
in diesem Raum zu Gegen- angriffen gegen die überlegenen Sowjets
an.
Shitomir
wurde trotz erbitterten Widerstandes eingeschlossen und am 20.November
wieder eingenommen. Mit diesem Erfolg aber wurde der geplante feindliche
Durchbruchsversuch aufgefangen.
Nach
heftigen Kämpfen gelang es der deutschen Panzerspitze, den
bolschewistischen Verteidigungsring um Shitomir aufzureißen. Zusammen mit
den Grenadieren dringen die Kampfwagen in die Vorstädte ein (oben links).
Im
Brennpunkt der Kämpfe stand die deutsche Infanterie. Neben den sichernden
Panzern schoben sich die grauen Schlangen gegen das Stadtinnere vor,
um an den entscheidenden Stellen mit nie versagendem Mut den bolschewistischen Widerstand zu brechen (ganz oben, links).
Über
ihre MG- und Protzenstellungen gingen die deutschen Panzer und was noch
übrig blieb, fraß das Feuer. Ein unentwirrbares Knäuel von Eisenteilen,
Rädern und zerschlagenen Motoren bedeckte die Straße.
Immer
neue Infanteriekolonnen stoßen nach (oben rechts), strömen in die
Seitenstraßen, kämpfen noch verbliebene Widerstandsnester nieder und
bringen nach erbittertem Ringen schließlich die Entscheidung. |
|
Der
schrille Lärm der harten Straßenkämpfe klingt noch in den Ohren dieser
Männer (rechts). Nun, da die Stadt sich wieder in deutscher Hand
befindet, dröhnt nur noch die Artillerie ostwärts der Stadt.
 |
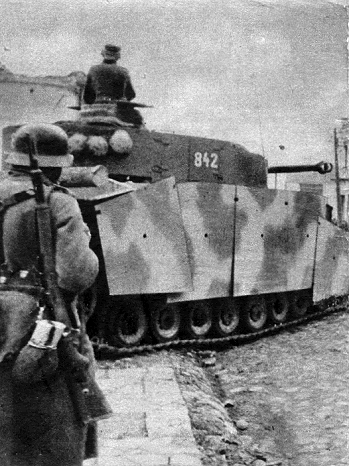
 |
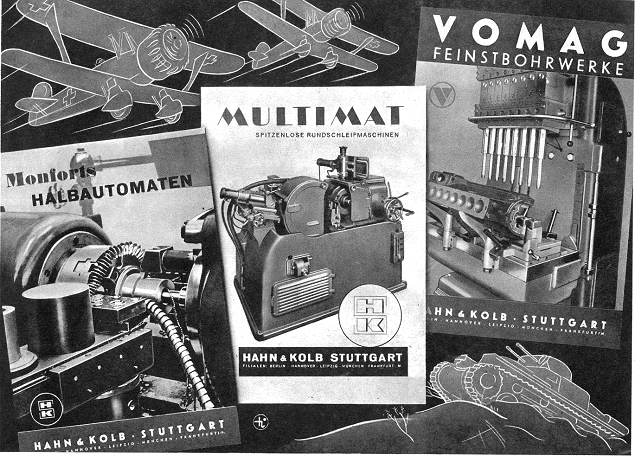
 |
|
Die
Kinder für eine "starke Militärzeit" versichern...
Die
Volksfürsorge - eine Versicherung, die heute noch existiert - warb
1943 mit einem Spruch, der in Anbetracht des bereits überschrittenen
Kriegserfolgs recht fragwürdig war. Für diejenigen Leser, die Probleme
mit dem Schrifttyp der unten links stehenden Werbung haben, ist hier der
Text "übersetzt" zu lesen:
Wer
will unter die Soldaten...
Schon
im kindlichen Spiel liegt die Sehnsucht nach der Erfüllung eines
Herzenswunsches: Auch mal Soldat zu werden!
"Schrittmacher",
der treue Weggefährte darf dabei nicht fehlen. Er weist den Eltern den
ersten Weg, durch eine jetzt abgeschlossene Militärdienst-Versicherung
dem Jungen später eine starke Militärzeit zu sichern.
Ich
überlasse es den Lesern, diese Art der Werbung zu bewerten.
"Überlegenheit"
während der Gegenoffensive des Gegners
An
der "Heimatfront" werden die Leser der Hefte "Die
Wehrmacht" mit immer neuen waffentechnischen "Vorsprüngen"
begeistert, die vernebeln sollen, dass alle Fronten ab 1943 zum Stillstand
gekommen oder auf dem Rückzug waren. Spätestens im ersten Winter des
Unternehmens "Barbarossa" wurde deutlich, welche
Fehleinschätzungen unterlaufen waren. Adolf Hitler persönlich war fest
davon überzeugt, dass Russland noch vor Einbruch des Winters 1941 besiegt
sein würde. Mit wahnwitzigen Truppenverschiebungen und Frontwechseln, die
sehr viel Zeit in Anspruch nahmen, verfehlte man das Ziel und die
Wehrmacht erstarrte bei Wintereinbruch förmlich im gefrorenen Schlamm. Es
fehlte an Winterkleidung, Maschinen und Geräte waren nicht
wintertauglich. Davon hat sich die Wehrmacht nicht mehr erholt. Zwar ging
es 1942 noch einmal kräftig in Richtung Südosten zur Sache, wobei man
sogar die Ölfelder hinter dem Kaukasus erreichte. Allerdings wurden die
Wege für den Nachschub immer länger und unkontrollierbarer
geworden.
Ende
1943 mussten sich die deutschen Soldaten zunehmend einer gigantische
Übermacht beugen und auch der technische Vorsprung schmolz dahin. So kam
es zu schnell zusammengeschusterten Superwaffen, wie dem
"Ferdinand" der Firma Porsche, einem Riesenpanzer mit 70 Tonnen
Gewicht und einer gigantischen Kanone, der kläglich versagte, weil er
über keine Maschinengewehre verfügte und somit eine leichte Beute für
Infanteristen wurde. Mit der "Hornisse", die wesentlich leichter
und beweglicher als der gleichstark bewaffnete Tiger-Panzer war, konnten
vorübergehend gute Erfolge gegen die zahlenmäßige Übermacht der
russischen Panzer erzielt werden. Von ihnen handelt der nachfolgende
Kriegsbericht. Dennoch blieb das Waffensystem nur eine Randnotiz des
Krieges.
|
 |

Von
Kriegsberichter v. Koerber im November 1943
|

Bolschewistischen
Panzern ist es geglückt in die vordersten deutschen Linien
einzubrechen. Ein Kradmelder jagt vom Gefechtsstand eines
Grenadierregiments nach hinten, um die schweren Panzerjäger zur
Verstärkung der Abwehr heranzuholen. |
 |
|
Die
in diesem Krieg allgemein steigende Leistungsfähigkeit der Panzer
erfordert eine immer höhere Qualität der Abwehr. Ursprünglich
genügte die leichte 3,7 Zentimeter-Pak, die von der Bedienung im
Mannschaftszuge durch das Gelände bewegt werden konnte. Die
weiteste Entfernung, in der die 3,7-Pak noch Panzer wirksam
bekämpfen konnte, lag bei 800 Meter. Da aber bei diesem großen
Abstand auf einen vorbeifahrenden Panzer weit vorgehalten werden
mußte und dadurch die Treffsicherheit litt, zog man Entfernungen
unter 300 Meter vor. Im Laufe dieses Krieges hat sich dies alles
grundlegend geändert. Es wurden immer bessere Abwehrkanonen
herausgebracht.
Die
Krönung aller Konstruktionen ist die deutsche "Hornisse",
eine 8,8 Zentimeter-Pak auf Selbstfahrlafette. Die
Anfangsgeschwindigkeit ihrer Geschosse ist so hoch, daß selbst auf
Panzer, die in großer Entfernung vorbeifahren, nur eine geringe
Vorhalte notwendig ist. Die besten sowjetischen Panzer T34 und KW1
sind ihren Granaten nicht gewachsen und fallen den
"Hornissen" oft schon, ehe sie ihr eigenes Hauptkampffeld
verlassen haben, zum Opfer. Wie vorzüglich sich die
"Hornissen" bewähren, zeigt die Tatsache, daß eine
einzige Abteilung schwerer Panzerjäger mit ihnen in zwei Monaten
fast zweihundert sowjetische Panzer abschoß. |
|
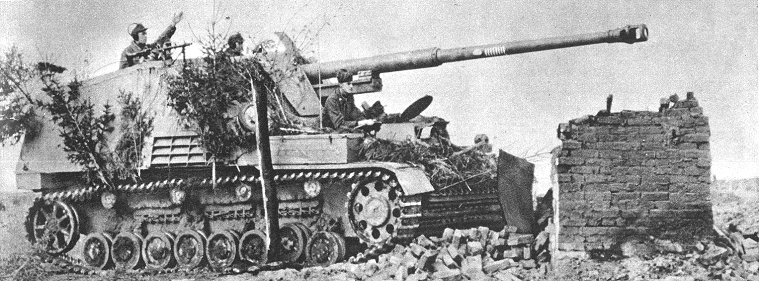 |
Ein
feindlicher Pulk, bestehend aus mehreren T34 und KW1 kommt in Sicht. Um
kein zu großes Ziel zu bieten, schiebt sich die "Hornisse" an
eine Deckung heran und eröffnet schon auf weite Entfernung den Kampf
gegen die Bolschawisten. |
|
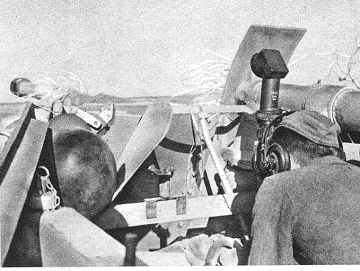
Oben:
Ein T34 steht genau im Fadenkreuz, ruckt wieder an, verschwindet für
Sekunden aus dem Zielgerät. Das Kanonenrohr verfolgt aber seine Fahrt,
bis er wieder im Fadenkreuz sitzt und der günstigste Moment zum Abschuß
gekommen ist.
Rechts:
Der Schuß der "Hornisse" hat gesessen. Die gesamte Besatzung
beobachtet gespannt den brennenden KW1. Wieder ein Abschussring mehr am
Kanonenrohr, der von ihren Erfolgen kündet.
|
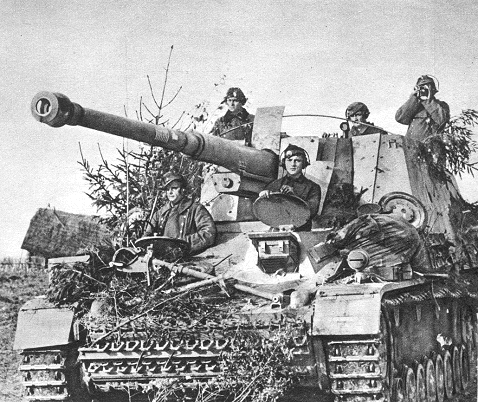 |
|

Von
der Geschicklichkeit des Ladeschützen hängt zum großen Teil der Erfolg
ab. Jeder Griff muß sitzen, damit die "Hornisse" blitzschnell
feuern kann. Zum Schutz gegen den starken Knall hat der Ladeschütze seine
Ohren durch Klappen geschützt. |
|
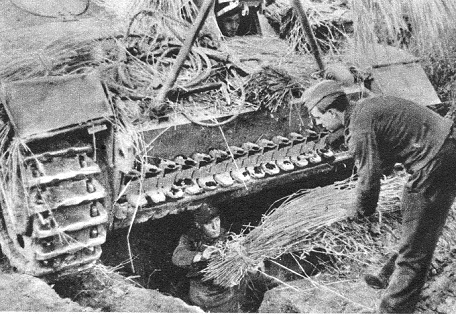
Ein
harter Tag ist vorbei! Die feindlichen Panzer, die nicht abdrehten, wurden
vernichtet. Die Panzerjäger ziehen ins "Quartier". In dem
breiten Loch unter dem Fahrgestell der "Hornisse" ist es zwar
kalt, aber dafür gibt es eine splittersichere Nacht. |
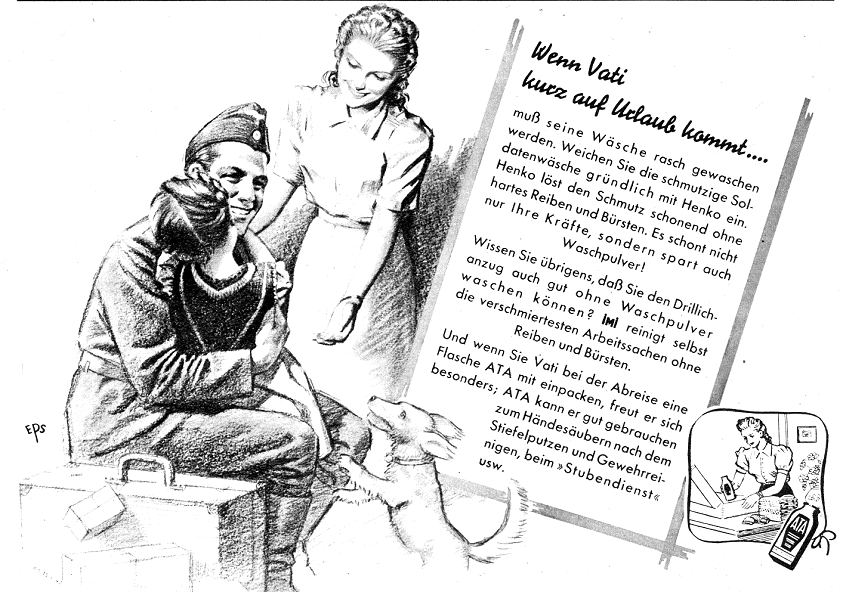
|
Panzer
auf dem Prüfstand
Die
deutsche Panzerwaffe nahm seit 1938 eine rasante Entwicklung. Mit dem
Panzer IV, der sich im Polen-Feldzug bestens bewährte, gelang ein großer
Wurf. Auch auf den darauf folgenden Kriegsschauplätzen war dieser
Panzertyp wegen seiner Wendigkeit und seiner Schnelligkeit dominant. Es
stellte sich schon bald heraus, dass auch verstärkt größere Panzer mit stärkerer
Bewaffnung gebaut werden mussten. So entstand der "Tiger", der
nach den Erfahrungen mit der 8,8 cm-Flak im Erdseinsatz mit eben dieser
Kanone ausgestattet wurde. Schon früh erkannten die Entwickler das Abschrägen der Aufschlagkanten
gegen mögliche Geschosse und das Verhindern einer allzu großen Lücke
zwischen Wanne und Turm, die bevorzugt vom Gegner anvisiert wurden. Richtig getroffen
flogen die gegnerischen Türme meist meterhoch durch die Luft. Die Achillesferse der deutschen
Panzer war im Osten die verminderte Tauglichkeit bei Frost. Hierauf hatten die
Sowjets in den Wintermonaten und zum Kriegsende die besseren technischen
Antworten. Während die deutschen Panzer bei starkem Frost oft zur
Bewegungsunfähigkeit verdammt waren, konnte der Gegner frei operieren.
Seine Panzer waren auf die Winterbedingungen ausgelegt.
Da
die Feldartillerie an erschwerter Mobilität litt, wurden immer mehr
Haubitzen mit Selbstfahrlafetten und Sturmgeschütze entwickelt. Auch hier hatte die deutsche
Wehrmacht die Nase vorn. Die Alliierten konnten mit ihren Entwicklungen immer nur nachziehen, ohne
je einen echten Vorsprung zu erzielen.
Ein
besonderer Kriegsschauplatz war Nordafrika. Hier mussten sich unsere
Konstrukteure auf völlig neue Luftfilter einstellen, die dem
Flugsand standhielten. Auch der Verschleiß im Kettenbereich war enorm.
Die Probleme bekam man aber recht schnell in den Griff und die deutschen Reparaturkolonnen
waren zudem unschlagbar. Sie richteten nach Panzerschlachten über Nacht
den größten Teil der Ausfälle wieder her und verblüffte den Gegner
trotz großer Ausfälle am Vortag immer wieder mit voller Kampfstärke. Die Alliierten reagierten auf die Wüstenanforderungen nicht in dem Maß,
wie es erforderlich gewesen wäre. Was die deutschen
Waffenkonstrukteure umtrieb, als sie die ersten
"Neuentwicklungen" des Gegners besiegt und erbeutet hatten, ist in der
nachfolgenden Berichterstattung nachzulesen, die im Heft Nr. 20 am 22.
September 1943 erschien.
|
 |
Der
erfolgreiche Einsatz der deutschen Tiger- Panzer zwang die Sowjets zum Bau
einer neuen Abwehrwaffe. Es entstand so ein schweres Sturmgeschütz, das
jedoch im Gegensatz zu den deutschen neuen Geschützen auf Selbstfahr-
lafetten keine Neukonstruktion darstellt, sondern durch einfache Montage
der schweren Feldhau- bitze 15,2 cm auf das Fahrgestell des KW I ent-
standen ist.
Während
die deutschen Selbstfahrgeschütze dazu bestimmt sind, den angreifenden
Panzern zu folgen, um sie durch ihr schweres Feuer nach vorne und gegen
die Flanke zu sichern, wird das sowjetische Sturmgeschütz in
verhältnismäßig kleinen Bereichen besonders zur Panzerbe- kämpfung
eingesetzt.
Die
Besatzung besteht aus 6 Mann, die durch drei Einstiegsluken in das Innere
des Panzers gelangen können (links). Im Gegensatz zur gewaltigen
Frontpanzerung, die besonders an der massiven Schutzkappe des Rohres zu
erkennen ist (unten), ist die Deckenpanzerung wesentlich schwächer.
Das
Gewicht des Kolosses liegt zwischen 50 und 60 Tonnen. |
 |
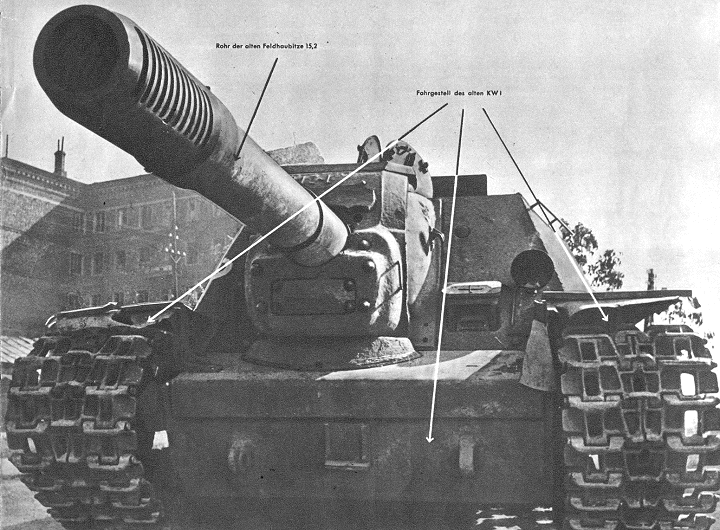
Auf
den Schlachtfeldern von Nordafrika, Sizilien und auch der Sowjetunion wurde in
den letzten großen Schlachten eine der vielen anglo-amerikanischen
Propagandalügen zerstört. Die Briten und ganz besonders die Amerikaner
gefielen sich schon lange darin, die Güte ihrer Bewaffnung in den Himmel zu
preisen und als unübertrefflich hinzustellen. So wurde auch mit viel Geschrei
der Versuch gemacht, die letzten Panzertypen als einmalige
Konstruktionsleistungen hinzustellen und ihnen ohne lange Bewährung die
Gloriole der Unbesiegbarkeit gegenüber den deutschen Abwehrwaffen umzutun. Im
Schmelztiegel der Schlachten und unter der Gewalt der deutschen Waffen ging
dieser billige Propagandaruhm dahin. Den Generalen "Grant" und
"Sherman", dem Panzer "Churchill IV" erwiesen sich unsere
Kampfwagen nicht nur ebenbürtig, sondern auch, und hier besonders der
"Tiger", überlegen. Unsere Zeichnungen zeigen Schnitte durch die drei
Panzertypen, die der Feind für seine besten hält.
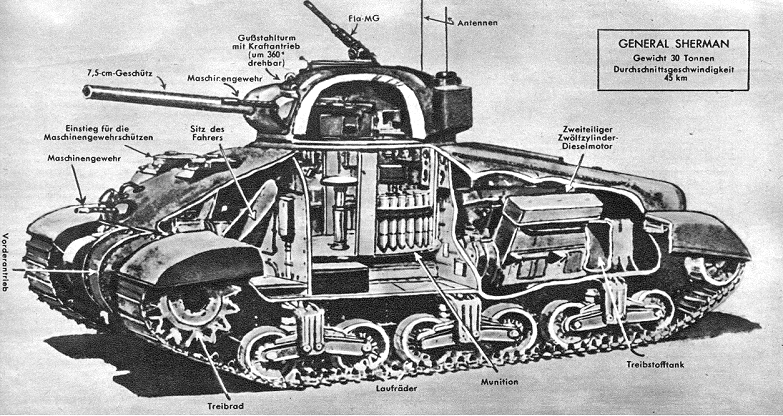
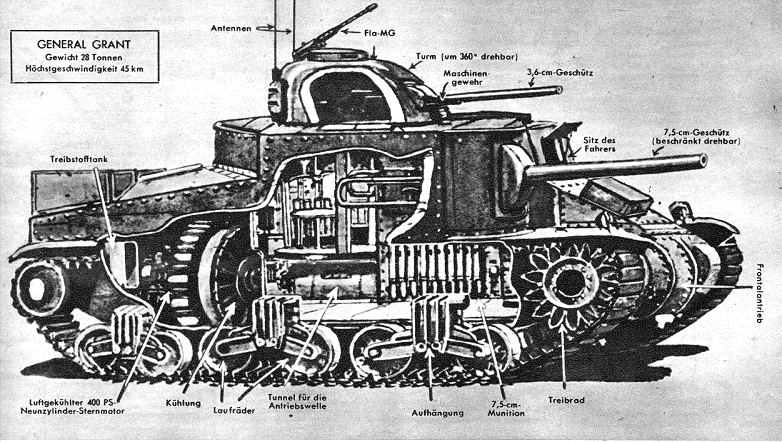
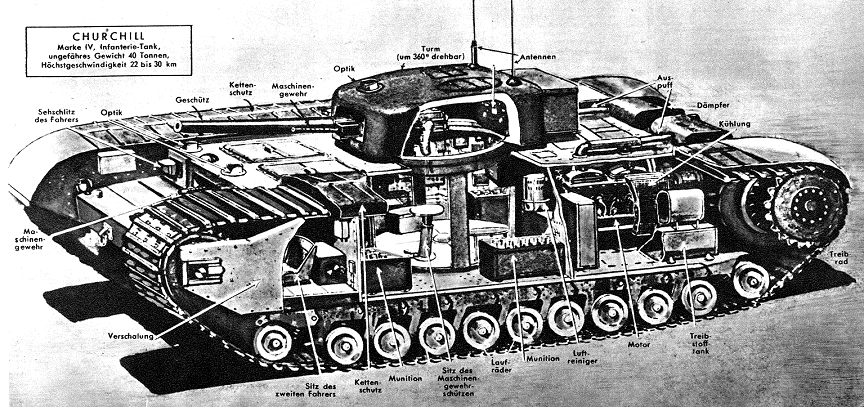
|
Schicksal
der Mennoniten zu Propagandazwecken missbraucht
Der
folgende Artikel, der in der Ausgabe Nr.8 vom 7. April 1943 erschien, wird
die Flucht der Mennoniten beschrieben, einer Sekte, die es im Bereich des
Kuban und Terek im Laufe der Jahre zu Wohlstand gebracht hatten. Trotz der
anfänglichen und von den Beteiligten als äußerst dramatisch erlebten
Schwierigkeiten im neuen Siedlungsgebiet entwickelten sich die
wirtschaftlichen Verhältnisse für die Siedler gut. Das Land eignete sich
zwar nicht für den klassischen mennonitischen Weizenanbau. Mit dem Obst-
und Weinbau erzielten sie jedoch gute Gewinne. Eine weitere Domäne war
die Vieh- und Pferdezucht der russlanddeutschen Mennoniten.
Der
Welt- und der Bürgerkrieg vernichtete schließlich die Kolonien der
Mennoniten im Kaukasus. Enteignung und Kollektivierung von Betrieben und
landwirtschaftlichen Nutzflächen beendeten schließlich die
wirtschaftlichen Grundlagen. Eine Verhaftungswelle zwischen 1937 und 1938
richtete sich auf dem Kuban, wie auch bei anderen christlichen Gemeinden
im Land, vor allem gegen geistliche Leiter und Lehrer. Den auf dem Kuban
im 2. Weltkrieg verbliebenen Mannoniten blieb nur die Verbannung nach
Kasachstan. Nur wenige konnten während des Krieges nach Deutschland oder
nach Nordamerika gelangen.
Diesen
Sachverhalt verschwieg der Verfasser des Artikels und lässt damit die
Leser im Glauben, das russische Volk sei generell vor den Bolschewisten
geflüchtet. Die Mennoniten wurden von den Sowjets wie Kollaborateure
behandelt, die ihre Haut zu retten versuchten.
|
|
Wanderung
in die Hoffnung

Zeichnung:
NSKK-Kriegsberichter Theo Matejko
Ein
Zug der Hoffnungslosen? Ein Heerwurm der Not? Eine Kavalkade des Elends?
Einer jener Trecks in die Gnadenlosigkeit Sibiriens, zum mordenden
Eismeerkanal, wie zwanzig Jahre bolschewistischer Geschichte sie zu
Tausenden sahen? - Nein!
Wenn
hier eine historische Parallele Gültigkeit haben kann, dann hat man an
die Züge der Buren zu denken, die mit Weib und Kind, mit Karren und
Ochsen und einer großen Hoffnung im Herzen vor der britischen Gewalt im
Kapland einen neuen Tag und einen neuen Acker im Norden suchten. Es sind
die Völker Kaukasiens, die Bewohner des Kaukasus-Vorgeländes, die
Männer, Weiber und Kinder vom Kuban und vom Terek, die freiwillig ihre
Heimat aufgaben und mit den deutschen Soldaten zogen, als diese sich im
Laufe der Winterschlacht vom Feinde absetzten.
Kein
deutsches Bajonett trieb sie, kein Befehl holte sie aus ihren Hütten und
kein deutsches Kommando räumte die Dörfer und Kolchosen. Als sich eines
Tages unserer Kaukasussoldaten in Marsch nach Westen setzten, um sich der
Klammer zu entziehen, die der Feind in ausholender Bewegung um sie legen
wollte, waren es diese Männer und Frauen, die zu den deutschen Soldaten
kamen und mitgenommen werden wollten. Da war keiner unter ihnen, der nicht
wusste, was das bedeutete: Hunderte von Kilometern im schneidenden
Schneesturm mit Kind, Hab und Gut mit den Deutschen und ihnen
nachzuziehen. Sie wussten das alles vielleicht besser als die deutschen
Soldaten. Sie wussten genau, dass mancher von ihnen am Wege blieb. Aber
sie wollten mit, und es war nicht nur die Furcht vor den sowjetischen
Horden, die die von den Deutschen hinterlassenen Lücken vielleicht
füllen würden. Es war das Grauen von den zwanzig Jahren, die hinter
ihnen lagen und die Hoffnung auf die Zukunft, die die deutschen Soldaten
mit sich nahmen, selbst wenn sie nach Westen zogen. Diese Wanderung eines
Volkes im Vorgelände des Kaukasus war eine Wanderung in die Hoffnung und
dieser Zug ein Zug des Vertrauens. Lieber in Mühsal den grauen Röcken
der deutschen Soldaten nachziehen, als wieder von der Woge der Sklaverei
überschwemmt zu werden! Sie baten, sie flehten darum, mitkommen zu
dürfen, und den deutschen Kommandeuren wird es nicht leicht gewesen sein,
den Flehenden die Erlaubnis zum Wandern zu geben, denn die unendlichen
Züge der Männer, Weiber und Kinder, der Schlitten und der Wagen konnten
ja irgendwann und irgendwo die Straßen so verstopfen, daß die
militärischen Aktionen erschwert werden. Aber man nahm sie dennoch mit,
denn man sah, dass sie nicht in Panik flohen, sondern wohlbedacht und
wohlbewusst sich auf den weiten Marsch nach Westen machten, daß sie sich
überlegt hatten, warum sie mit den Deutschen ziehen wollten. |
|
 |
|
|
Das
MG 42 - das Schlachterwerkzeug der Front
Das
Maschinengewehr MG 42 bekam seinen Namen wegen der Indienststellung im
Jahr 1942. Es löste das veraltete Maschinengewehr MG 34 ab. Mit
einer Kadenz von 1200 bis 1500 Schuss je Minute war es jedem anderen
Maschinengewehr überlegen. So ist es nicht verwunderlich, dass ihm
Hunderttausende ihre Verwundung oder den Tod verdanken. Normalerweise
betrug die Kampfentfernung auf dem Zweibein bis zu 800 Meter. Auf einer
Lafette und mit Optik ausgestattet waren Schussentfernungen von 3000-3500
Meter mit befriedigender Treffsicherheit realisierbar. Das MG 42 war als
"elektrisches Gewehr" bekannt und sehr gefürchtet. Verschiedene
Quellen behaupten, es seien davon 415.500 Stück gebaut worden. Erfunden
und entwickelt hat es Werner Gruber, der als Techniker
bei der Metall- und Lackwarenfabrik Johannes Großfuß bei Döbeln in
Sachsen beschäftigt war. Die Hersteller waren anschleißend die MAUSER
WERKE AG, die Wilhelm-Gustloff-Stiftung, Styrer-Daimler- Puch, die
Großfuß AG und MAGET (Maschinenbau und Gerätebau GmbH, Berlin-Tegel).
|
|

Seit
einem Jahr befindet sich das neueste und schwerste MG der deutschen
Wehrmacht im Einsatz. An allen Fronten hat es sich bewährt und bewährt
sich heute Tag für Tag. Es wird von den Gegnern, die eine gleichwertige
Waffe dieser Art nicht besitzen, gefürchtet, namentlich von den Sowjets,
die dem MG wegen seiner außerordentlich hohen Feuergeschwindigkeit
den Beinamen "elektrisches Gewehr" gegeben gaben. Unsere
Aufnahmen wurden bei einer im Nordabschnitt der Ostfront eingesetzten
Luftwaffen-Feldeinheit gemacht.
|
|


|

Keine
Sekunde weicht das Auge vom Richtgerät. Jetzt ist es soweit. Der Feind
muss für einen Augenblick seine Deckung verlassen, um vorwärts zu kommen
aber dieser Augenblick würde für ihn die Vernichtung bedeuten.
|

|
|
Exotischer
Kriegsschauplatz
Der
Kriegsschauplatz in Nordafrika war nicht gerade von herausragender strategischer
Bedeutung und hätte nur dann einen Sinn gehabt, wenn sich die Fronten
rund um das Mittelmeer hätten vereinigen lassen und dadurch der Weg zu
den Ölquellen frei gewesen wäre. Dennoch beeindruckte Feldmarschall Erwin Rommel mit seinem Afrika-Korps
die ganze Welt und selbst die ehemaligen Gegner halten heute noch die Mythen
Rommel und Montgomery hoch, die sich in Taktik und Raffinesse um nichts
nachstanden. In Nordafrika gab es keine Bodenschätze und auch sonst
nichts zu holen. So war es ein reiner Prestigekampf zwischen Engländern,
Deutschen und Italienern. Die Namen der Wüsten- und Küstenstädte haben noch heute eine guten und
einen geradezu mystischen Klang.
Legendär
sind die wüstenabhängigen Regelungen, die untereinander üblich waren. So gab es rund um
viele Oasen und Wasserlöcher eine Zone, in der die Waffen schwiegen. Hier
trafen sich die Gegner beim Wasserfassen und plauderten sogar miteinander.
Man tauschte Zigaretten und Erfahrungen aus und nahm sich gelegentlich gegenseitig auf
die Schippe. Für eine kurze Zeit war man sich einig, förmlich sogar
Schicksalsgenosse, ehe man in einiger
Entfernung vom Wasserloch wieder aufeinander schoss. Es wurde nie ein Fall
bekannt, bei dem ein Wasserloch unbrauchbar gemacht oder gar vergiftet
worden wäre.
Von diesem Kriegsschauplatz handelt
der nachfolgende Bericht.
|
FRONT
NORDAFRIKA
Verfolgung
des geschlagenen Gegners
|

Unsere
Artillerie bekämpft Panzerkraftwagen bei Marsa el Brega in
direktem Beschuss und gönnt
dem
Gegner keine Zeit, sich zur Verteidigung einzurichten |

Generalleutnant
Rommel befindet sich in vorderster Linie in einer
Besprechung
mit den Offizieren seines Stabes über den Einsatz der Luftwaffe |
|
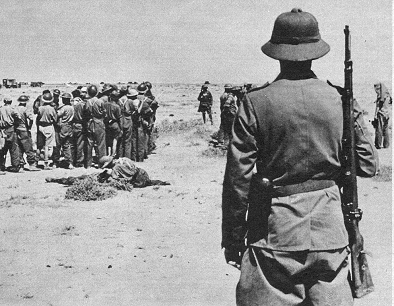
|
links:
Am
Sammelplatz für
gefangene
Engländer
unmittelbar
vor dem
Abtransport.
Ein
Verwundeter wird
sorgsam
betreut.
rechts:
Mit
schussbereitem Gewehr,
vorsichtig
Umschau haltend,
wird
Haus um Haus nach
Engländern
durchsucht. |

|
|

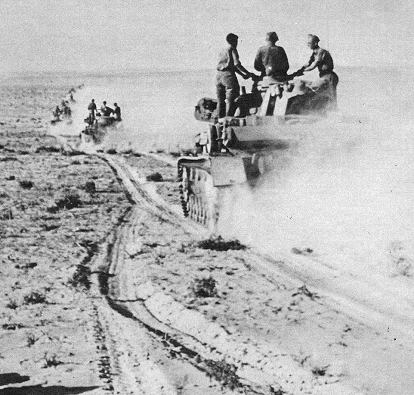
links:
Pioniere stoßen mit der Spitze der Panzerverbände vor, um Minensperren
zu beseitigen
|
 |
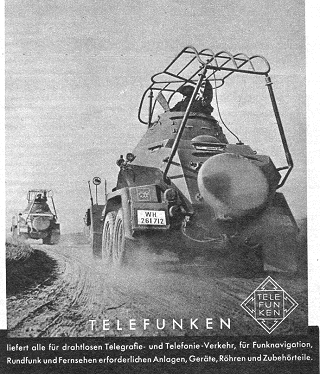
|
Agedabia
erreicht! 1000 Kilometer von Tripolis entfernt rollen unsere Panzerwagen in
die Stadt.
Unter
dem Stadtschild der Wegweiser nach Bengasi.
|

Bild
unten:
Der
Panzer brennt lichterloh, nur einer der Fahrer konnte sich retten
und
geht in Gefangenschaft. |

Noch
sind überall die Spuren der Kämpfe zu sehen. Sandsäcke als MG-Deckung,
verbeulte
leere Benzintonnen, eine stehen gelassene Zugmaschine. Vor Stunden
erst
flohen die Engländer vor den vorrückenden deutschen und italienischen
Truppen. |
|
Amerikanische
Ängste nährten pessimistische Visionen
Die
Angriff der Japaner auf den größten Flottenstützpunkt der Amerikaner Pearl
Harbour am 7. Dezember 1941, bei dem die amerikanische Marine
schwerste Verluste erlitt, wirkte auf die Psyche der Amerikaner ähnlich,
wie das Attentat auf die Twin-Towers in New York am 11. September 2001.
Beides geschah völlig unerwartet und erschütterte das amerikanische
Rechts- und Sicherheitsempfinden. Am 8. Dezember 1941 trat Amerika in den
2. Weltkrieg ein und hatte es anschließend mit den geographischen Zwergen
Japan und Deutschland aber dennoch mit militärischen Großmächten zu
tun.
Die
öffentliche Meinung war nicht einhellig, was die Notwendigkeit des
amerikanischen Kriegseintritts betraf, denn ein Teil der amerikanischen
Bevölkerung hatte deutsche Wurzeln. So war man in der Presse bemüht,
alle möglichen Gründe nachzuliefern, die eine Bedrohung der USA belegen
sollten. Die Kampagne ist durchaus mit der vergleichbar, die den
Irak-Krieg nach dem Attentat auf die Twin-Towers im Jahr 2001 flankierte.
Die begrenzte Sicht des Durchschnittsamerikaners auf globale
Zusammenhänge war und ist auch heute noch eine gute Basis für das
Zusammenwirken von Wirtschaftsstrategen und Kriegsgewinnlern mit der
Politik und dem Militär. Die Bevölkerung nimmt ihnen die Notwendigkeit
der Kriege ab. Korea, Vietnam, Irak oder Afghanistan - das Dilemma setzte
sich fort. Das amerikanische Volk zahlte stets den Blutzoll, den auch
andere Nationen für Wirtschaftsinteressen zahlten. Ein hoher Preis! Man ist stolz
auf die erste Atombombe und auf alle technischen Fortschritte der Entwicklung bis hin zur Mondlandung, die ohne die Kriege
nicht so schnell erreichbar gewesen wären.
Der
nachfolgende Artikel, der in der Ausgabe DIE WEHRMACHT Nr. 11 vom 20. Mai
1942 erschien, nahm auf einen Artikel des Magazins "Life" vom 2.
März 1942 bezug. Ein Schriftsteller durfte in diesem Magazin seine ganz
persönlichen Visionen vom Erreichen einer Weltherrschaft der
Achsenmächte zelebrieren. Dabei baute er auf das bruchstückhafte
Wissen der Amerikaner, das sie der Presse entnahmen. Hier standen die
"Blitzkriege" der Deutschen, der Kriegsschauplatz in Nordafrika,
der U-Boot-Krieg, der Angriff auf die Großmacht Sowjetunion und die
vor New Orleans operierenden deutschen U-Boote im Fokus. Die Erfolge der
japanischen Streitkräfte, die ebenfalls kein Ende nehmen wollten, rundeten die Angst der amerikanischen
Bevölkerung ab.
Vor
diesem Hintergrund ließ sich vortrefflich Kriegspropaganda betreiben. Mit
den deutschstämmigen Amerikanern hatte man insgeheim auch schon die
"fünfte Kolonne" ausgemacht. Der Artikel zeigte alle Urängste
der Amerikaner und spielte mit ihnen. Die durch die Rüstung aufblühende
amerikanische Wirtschaft, die dem Krieg eine positive Seite lieferte,
wischte viele Bedenken weg. War man nicht schon längst in den Krieg
eingetreten, indem man England mit Waren unterstützte? Mit der Einberufung
der Soldaten nach Kriegseintritt sank auch nochmals die
Zahl der Arbeitslosen bis zur Vollbeschäftigung. Das hatten die Deutschen
eindrucksvoll vorexerziert. Die Deutschen und die Japaner verbreiteten
Angst und Schrecken: Da kam es ganz gelegen, wenn man dem
Durchschnittsamerikaner klar machen konnte, dass der Feind bereits vor der
Tür stand. Vielleicht erinnern sich noch einige unserer Landsleute, wie
lange im "Kalten Krieg", der Fortsetzung des 2. Weltkriegs mit
anderen Fronten, damals "der Russe vor der Tür" stand. Die
propagandistischen Mittel sind zu allen Zeiten gleich.
Fatal
ist, dass sich später bezüglich der japanischen Eroberungszüge
erstaunliche Übereinstimmungen mit manchen Visionen oder Befürchtungen
ergaben, die nur mit großen Verlusten wieder korrigiert werden
konnten.
|
 |

|
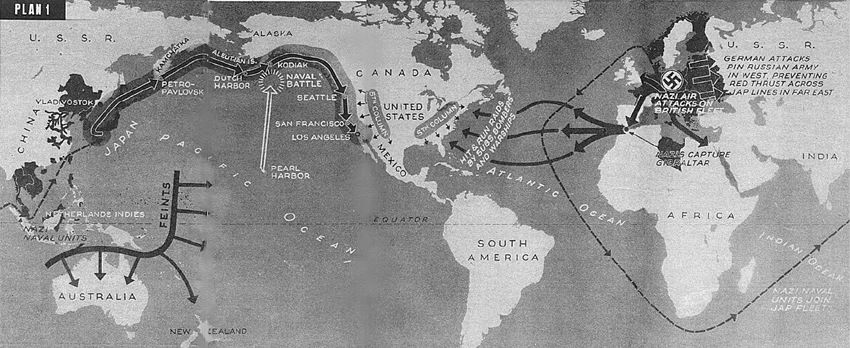 |
|
Der
erste Plan: Die
Japaner (weiß umrandete schwarze Pfeile) unternehmen einen Großangriff
über dem nördlichen Pazifik. Gleichzeitig treten sie in den Krieg gegen
die Sowjets ein, die von Deutschland auf der anderen Seite gegen die
japanischen Linien gedrängt werden. Der Angriff gegen die USA beginnt mit
einem Überfall der gesamten japanischen Flugzeuge und der durch deutsche
Schlachtschiffe verstärkten Flotte auf den US Stützpunkt Dutch Harbour.
(Die Strichlinie zeigt die deutsche Flotte auf dem Marsch nach Japan) In
der weiteren Folge erobern die Japaner verschiedene Luftbasen und stoßen
dann an der amerikanischen Westküste nach Süden. Die fünfte Kolonne
steht dort in Reserve und öffnet den Eindringlingen das Land. Nachdem die
Japaner an der Westküste Amerikas festen Fuß gefasst haben, landen die
Deutschen, die vom eroberten Gibraltar kommen, an der Ostküste: Ein
gleichzeitiges Flottenmanöver richtet sich gegen Australien und den
Pazifik. |
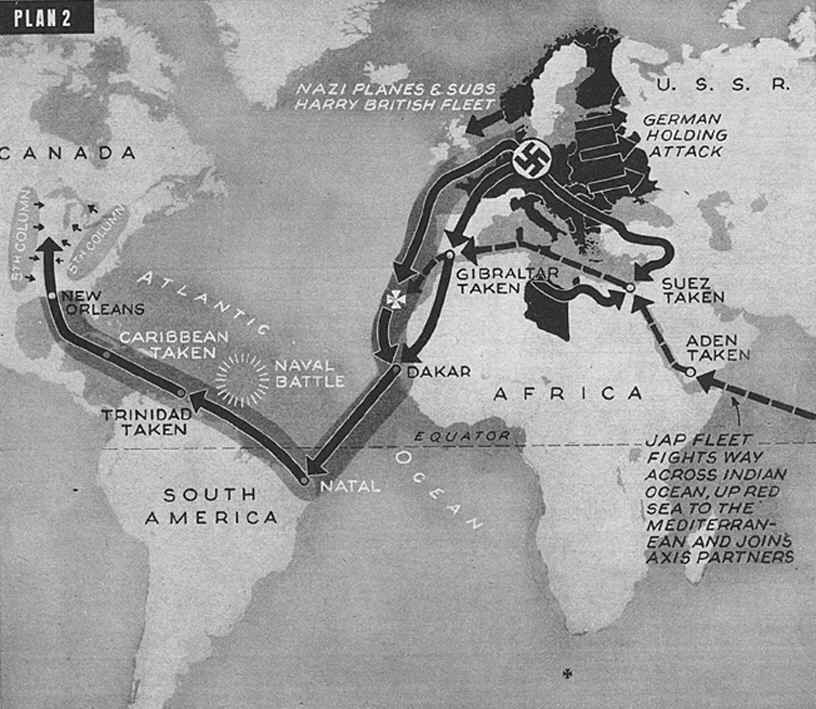 |
|
Plan
2: Dies
soll der Weg der meistbesprochenen Invasion sein. Der Schauplatz ist der
Atlantische Ozean. Verschiedene Probleme sind bereits eindeutig gelöst.
Gibraltar ist genommen, Aden und Suez sind gefallen und der japanischen
Flotte ist der Weg durch das Rote Meer und die Straße von Gibraltar frei
gemacht. Dieses Angriffsunter- nehmen über Gibraltar - Dakar - Natal -
Trinidad kann nur dann glücken, wenn sich die japanische, italienische
und deutsche Flotte vereinigen. Von Brasilien geht es dann nach Norden und
die Invasion erfolgt mit Hilfe der fünften Kolonne das Missisippi-Tal
aufwärts. |
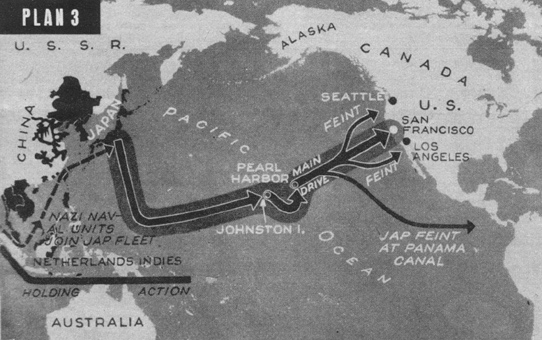 |
 |
|
Plan
3: Diesmal
greifen die Japaner quer über den Pazifik, wieder vereinigt mit den
deutschen Schlachtschiffen, die amerikanische Westküste an. Der Verfasser
meint, der einfachere Teil wäre, mit Flugzeugunterstützung auf den
Hawaii-Inseln (Pearl Harbour) zu landen. Schwieriger sei dann der weite
Weg nach San Franzisko und der Angriff auf den Pananamakanal. |
Plan
4: Die
Japaner nehmen den Weg über den südlichen Pazifischen Ozean. Wieder hat
die japanische Flotte, verstärkt durch die deutsche, die Überlegenheit
über die US-Flotte. Der Kampf würde wahrscheinlich mit einer
überraschenden Bombardierung des Panamakanals beginnen, der eine Landung
in Ecuador erfolgt. |
 |
 |
| Plan
5: Dies
ist nach Ansicht des Mr. Wylie der schwierigste Weg über den Atlantik.
Die vereinigten Achsenflotten besetzen die atlantischen Inseln; sie fallen
über die Azoren und Bermudas in Norfolk ein. Der Verfasser meint, die
Hauptsorge der Achsenstreitkräfte wäre, die amerikanische
Luftüberlegenheit auszuschalten. |
Plan
6: Und
hier die klassische Invasion! Sie führt durch die Täler des
St.-Lorenz-Stroms und des Hudson nach Süden. Vorher werden Island und
Grönland ohne weiteres genommen. In diesem Falle halten die deutschen
Unterseeboote und Flugzeuge die britische Flotte rund um die englischen
Inseln in Schach. |
|

|

|
|
An
allen Fronten ließen Soldaten aller Nationen ihr Leben für einen
sinnlosen Krieg und ihre Gräberzeilen reichten nach dem Krieg oft
bis zum Horizont. Heute noch werden jährlich Tausende von
Leichenfunde freigelegt und auf Friedhöfen umgebettet. Das Deutsche
Rote Kreuz komplettiert so auch über 60 Jahre nach Kriegsende
noch Unterlagen, die über den Verbleib von Vermissten Auskunft geben.
Oben rechts ist ein Friedhof in Weißrussland zu sehen, der aus dem
fahrenden Truppentransport heraus im Winter 1942 fotografiert wurde.
Das
unten stehende Bild entstand 1943 auf dem Rückzug und zeigt eine
der wenigen Einheiten, die noch mit Pferden ausgestattet waren.
Mensch und Tier hatte große Strapazen zu überstehen, denen
gegenüber die strotzende BORGWARD-Reklame als blanker Hohn
anzusehen ist. Werbung und Wirklichkeit - ein Kontrast spricht
Bände!
|
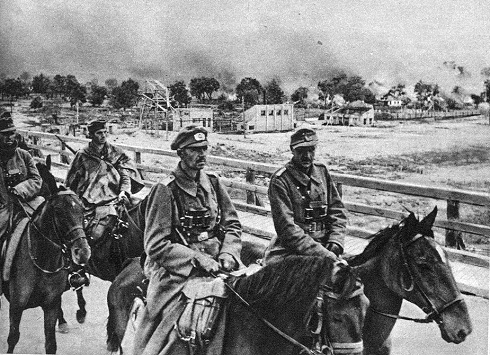
|
 |
|
Der
ganze Stolz der Marine war die U-Boot-Waffe
Man bezeichnete sie als
"Wölfe der Meere", weil sie regelrecht jagten, wie die Wölfe.
Zu Beginn des Krieges waren die Abschusszahlen und die versenkten Tonnagen
atemberaubend. Mit der Erfindung des Radars und der Erbeutung einer Enigma-Maschine, mit der die Funksprüche
der U-Boote verschlüsselt wurden, sank der
Stern der U-Boote und aus den Jägern wurden Gejagte. Die Passage des
Ärmelkanals und andere Meerengen, wie Gibraltar, wurde zum Höllenritt
und die englische und amerikanische Luftwaffe hatte nach Erringen der
Lufthoheit ein leichtes Spiel.
Vor
jeder Ausfahrt waren jedoch umfangreiche Vorbereitungen notwendig, die
gerade an der Atlantikküste genau beobachtet und an die Gegner weiter
gegeben wurden. So hatte man einen Überblick über mögliche Aufträge
der U-Boote und deren möglicher Einsatzzeit.
|
U-Boot
läuft aus
Ehe
ein voll aufmunitioniertes U-Boot ausläuft, muss erst noch Verpflegung für
viele Tage auf offener See gefasst und verstaut werden. In den Booten ist jeder
Zentimeter verplant. Frisches Gemüse ist für lange Seefahrten als
Vitaminspende wichtig. Das Einladen der Verpflegung dauert stundenlang, da alles
durch die engen Einstiege ins Innere befördert und dort an allen nur
erdenklichen Stellen verstaut werden muss. Nicht nur ein Schinken ist es, der so
nach unten geht. Kartoffelsack um Kartoffelsack wandert ins Innere. Schwerer
Dienst erfordert abwechslungsreiche Kost.

 
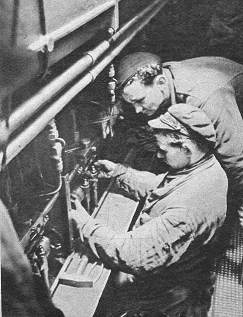
 
 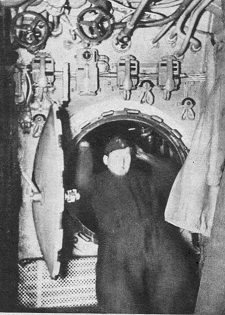
Neben
den Lebensmitteln werden auch Sicherungen benötigt und eine Vielzahl
elektrischer Kleinigkeiten finden ihren Weg nach unten.
|
Ein
Angriff von vielen
Im
nachfolgenden Bericht geht es um den Ablauf eines U-Boot-Angriffes, wie er
tausendfach während des Krieges stattfand. In vielen Spielfilmen und
Dokumentationen, besonders aber im Film "Das Boot", wurde die
besondere Atmosphäre unter Wasser und auf engstem Raum aufgegriffen, weil
es eine der nervenaufreibendsten Sachen war, die vom Menschen alles
abverlangte. Tagtäglich suchten ängstliche und besorgte
Besatzungsmitglieder auf Einzelfahrern und im Konvoi fahrenden Schiffen
die See nach Hinweisen auf U-Boote ab, um nicht ohne jede Vorwarnung
versenkt zu werden. Es gab Matrosen, die mehrmals auf versenkten Schiffen
fuhren und immer wieder anheuerten, weil die Heuer recht hoch war. Der
Preis dafür war es aber auch.
Zu Beginn des Krieges war es auch
üblich, dass U-Boot-Kommandanten unbewaffnete Frachtschiffe vor der
Versenkung warnten und der Besatzung Zeit ließen, sich in Sicherheit zu
bringen. Auch ist von einigen U-Boot-Fahrern bekannt, dass sie
Rettungsboote ins Schlepp nahmen, um sie neutralen Schiffen zu übergeben.
Nachdem das jedoch ihre Position verriet und sie oft danach eine leichte Beute
wurden, wurde fortan ohne jede Vorwarnung torpediert. Bei Tankern gab es
dabei
für die Mannschaften in der brennenden See keine Rettung.
Geleitzugfahrern war es zudem nicht gestattet, die Formation zu verlassen,
wodurch sie hätten Schiffbrüchige aufnehmen können. Auf beiden Seiten
hatte ein Untergang etwas absolut tödliches.
In
Heikendorf an der Kieler Förde befindet sich das U-Boot-Ehrenmal, das zum
Gedenken an die knapp 40.000 U-Boot-Fahrer errichtet wurde, die im zweiten
Weltkrieg ihr Leben ließen. Sie befuhren praktisch alle Weltmeere und
waren auf den üblichen Routen der Handelsschiffe rund um Afrika aber auch
im Nordatlantik zu finden.
Der
nachfolgende Bericht ist relativ frei von Propaganda und Pathos und zeigt
nüchtern, wie es bei den Kampfhandlungen zu ging.
|
|
Rohr
2 - los!
"Zur
See wird in diesem Frühjahr der U-Boot-Krieg beginnen", verkündete
am 30. Januar 1941 in einer großen Rede der Führer und Oberster
Befehlshaber der Wehrmacht.
England
hat inzwischen, obwohl wir noch nicht im Frühjahr sind, bereits am
eigenen Leibe gespürt, dass der U-Boot-Krieg, der ihm vom Beginn des
Krieges an ohnehin schon viel zu schaffen gemacht hat, jetzt tatsächlich
"beginnt". Die Versenkungszahlen steigen; in einem einzigen
OKW-Bericht (vom 25. Februar) konnte die Versenkung von mehr als einer
Viertelmillion BRT gemeldet werden. Das sind Zahlen, die durch keine
britische Lügentaktik verwischt und verkleinert werden können. Den
Hauptanteil hatte an dem erwähnten Tag die U-Boot-Waffe.
Wie
ein U-Boot-Angriff vor sich geht von dem Augenblick an, in dem das
feindliche Schiff gesichtet ist, bis zur Versenkung, zeigen in großen
Zügen die folgenden Aufnahmen. |
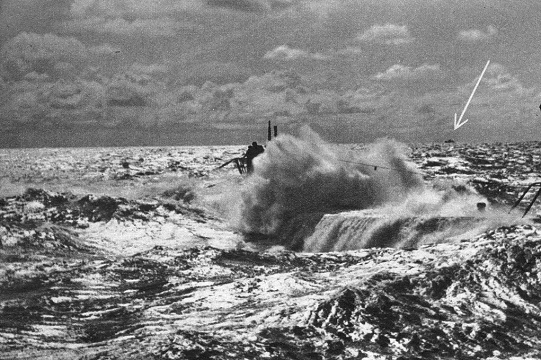 |
Steuerbord
voraus wird vom Ausguck eine Rauchwolke gesichtet. Der Kommandant lässt Kurs
auf den feindlichen Dampfer nehmen (oben: siehe Pfeil) und versucht, durch das
Glas die Art des Schiffes und seine Fahrtrichtung festzustellen. Da sich der
Dampfer innerhalb des deutschen Sperrgebiets befindet und in "spitzer
Lage", also für das U-Boot in günstiger Angriffsposition liegt, befiehlt
der Kommandant durch das Mikrofon: "Auf Tauchstation!"
Der
Angriff in schematischer Darstellung
Unsere
Zeichnung (unten Mitte) zeigt den feindlichen Dampfer, wie er im Sehrohr
sichtbar wird. Aus der Entfernung der beiden Mastspitzen kann der
U-Boot-Kommandant den ungefähren Kurs des feindlichen Schiffes feststellen. Die
beiden Masten sind am weitesten auseinander, sobald der Dampfer rechtwinklig zum
Kurs des U-Bootes fährt. Aus der Skizze wird die Bestimmung des sogenannten
Zieldreiecks mit dem Vorhaltwinkel ersichtlich: Das U-Boot hat den feindlichen
Dampfer in der Sichtposition am Horizont gesichtet. Der U-Boot-Kommandant stellt
nun Kurs und Geschwindigkeit des Schiffes fest, während der Obersteuermann mit
diesen Werten die beste Angriffsposition und das Zieldreieck errechnet. Da der
Torpedo vom U-Boot bis zum feindlichen Dampfer eine bestimmte Laufzeit braucht
(abhängig von der Entfernung der Dampfer- und der Torpedogeschwindigkeit) ,
kann der Kommandant nicht direkt auf das feindliche Schiff zielen, sondern er
muss um einen bestimmten Vorhaltewinkel, in unserem Fall 20 Grad, vor den Bug
des Schiffes halten. Diesen errechneten Vorhaltewinkel stellt nun der Kommandant
am Sehrohr ein, so dass der Dampfer um diesen Vorhaltewinkel früher im Sehrohr
erscheint. Auf diese Weise ergibt sich das in unserer Skizze angegebene
Zieldreieck, dessen Seiten die Fahrtrichtung des Schiffes, die Sichtlinie und
die Torpedolaufbahn bilden.
Sofort
verlassen die vier Ausguckposten (jeder hat von ihnen während der
Überwasserfahrt einen Sektor von 90 Grad genau zu beobachten) den Turm mit dem
Ruf: "Abwärts!". Als letzter steigt der Kommandant ein und schließt
das Turmluk wasserdicht. Auf das Kommando: "Alles auf Tauchstation!"
eilen die Männer blitzartig auf ihre Posten. Auf den Befehl des Kommandanten:
"Auf Seerohrtiefe gehen!" hat der leitende Ingenieur, dessen
Kommandostand in der Zentrale ist, fluten lassen. Das Sehrohr wird ausgefahren,
während die beiden Tiefensteuerleute das Boot in der gewünschten Wassertiefe
halten.
"Bug
links, Lage 30, Obersteuermann, Frage Angriffskurs?" Schnell hat der
Obersteuermann mit seinen Messgeräten und Tabellen den Kurs ermittelt und
schon wenige Sekunden später meldet er seinem Kommandanten "Angriffskurs
ohne Vorhalt 280 Grad". Inzwischen hat der Kommandant durch das Sehrohr die
Geschwindigkeit des feindlichen Schiffes festgestellt "Gegner fährt 12,
Lage 90, Frage Vorhalt". "Vorhalt 20", antwortet der
Obersteuermann, "Angriffskurs mit Vorhalt 260 Grad".
Nun
beginnt das übliche Katz- und Mausspiel. Um möglichst ungesehen die
Angriffsposition zu erreichen, befiehlt der Kommandant "Auf 12 Meter
gehen" - "Sehrohr vorsichtig ausfahren!" Um nicht gesehen zu
werden, lässt der Kommandant das Sehrohr immer nur für kurze Zeit ausfahren,
zwischendurch gleicht er die Fahrtstufe seines Bootes der Geschwindigkeit des
feindlichen Dampfers an. Nach langem aufregenden Spiel hat endlich das U-Boot
seine Angriffsposition erreicht. Schnell werden noch die Angriffswerte der
neuen Lage entsprechend korrigiert und dann ist es soweit... !
Immer
wieder hat der Kommandant seine Besatzung durch das Mikrofon über die Lage des
Kampfes orientiert. Es herrscht höchste Spannung, da ertönt das Kommando:
"Rohr 2 klar machen zum Unterwasserschuss!" Der Torpedomaat bewässert
das Rohr, füllt die Luftpatrone, die den Torpedo aus dem Rohr treiben soll, auf
und spannt den Verschluss. Kurz danach befiehlt der Kommandant:
"Mündungsklappe öffnen!" Schnell überprüft der Kommandant noch
einmal seine Einstellung im Sehrohr. Das U-Boot ist nicht gesichtet worden, kein
Mann der feindlichen Besatzung ahnt die kommende Katastrophe. "Rohr 2
fertig!" Langsam nähert sich das Bild des feindlichen Dampfers dem
Fadenkreuz. Endlich ist es soweit: "Rohr 2 - los!"
Mit
der Stoppuhr in der hand überprüft der Torpedooffizier die Laufzeit des
Torpedos. "60,,,, 40...,25..., 10...., 0.
Da
- eine ungeheuere Detonation, der Schuss hat gesessen.
Der
Kommandant hat durch das Sehrohr den Erfolg seines Angriffes festgestellt, da
meldet auch schon der Posten am Unterwasserhorchgerät: "Schraubengeräusch
aus 30 Grad!" Der Kommandant befiehlt: "Auf größere Tiefe
gehen!" Der Posten: "Schraubengeräusch wird stärker,
scheint feindlicher Zerstörer zu sein." Der Kommandant: "E-Maschinen
stopp! - Größte Ruhe im Schiff!" Es folgen bange Minuten für die
Besatzung. Da wird auch schon das Schiff von heftigen Detonationen erschüttert,
Gläser klirren, ein Teil der Lichtleistung fällt aus, es beginnt die Jagd auf
Leben und Tod. Endlich, nach stundenlanger Verfolgung, glaubt der Tommy, das
deutsche U-Boot zerstört zu haben. Der Unterwasserhorchposten meldet:
"Schraubengeräusch verliert sich in Richtung 105 Grad." Kurze Zeit
später taucht auch das U-Boot, nachdem der Kommandant vorher durch das Sehrohr
die Umgebung ab gesucht hat, wieder auf.


|
Der
Blitzkrieg im Westen
Die
"Blitzkriege" gegen Polen und Frankreich versetzten die
Kriegsgegner und denen das noch bevor stand in Erstaunen. Eine variable
Kampfesführung und unerhörte waffentechnische Überlegenheit am Boden
und in der Luft ließen den Gegnern kaum eine Chance. Dem Feldzug gegen
Frankreich ging die Einnahme von Belgien und Holland voraus, die aus
taktischen Gründen einfach überrannt wurden. Bis heute ist das Vorgehen
höchst umstritten. Der Grund war die ungeschützte Nordflanke der
Franzosen und die starken Bunkeranlagen entlang der Grenze zu Deutschland,
die nicht so leicht einzunehmen waren. So aber drang die Wehrmacht von
Norden kommend hinter die französischen Linien und die Befestigungswerke,
die nun leicht einzunehmen waren. Den Franzosen blieb nur eine veränderte
Strategie, die im nachfolgenden Bericht mit "Krieg an der
Straße" bezeichnet wurde.
Der
Bericht hält sich zwar an die tatsächlichen Abläufe, ist aber in der
Wortwahl nicht ausreichend objektiv. Es ist eine alberne Marotte, den
Gegner stark zu reden, damit die eigenen Erfolge in umso strahlenderem
Licht stehen. So kommt die Unterstürzung durch die Luftwaffe viel zu
kurz, die zusammen mit der Artillerie den Vormarsch sehr effektiv ebneten.
Die französische Luftwaffe wurde schon recht früh am Boden und in der
Luft zerstört, so dass unsere bei der Verteidigung in der Luft etwas
schwerfälligen Stukas leichtes Spiel hatten. Die Franzosen kämpften
mutig und entschlossen und fügten der Wehrmacht große Verluste zu.
Die immer wieder gegeißelte Strategie der französischen Heeresleitung,
die kleinen Städte und Dörfer sowie die vielen Gehöfte für Paris zu
opfern, war aus der Not heraus geboren und weniger in niederer Absicht
gefasst. Unter dem Strich zählt allerdings das Ergebnis: Der
Frankreich-Feldzug wurde zum Blitzkrieg und endete zunächst damit, dass
die Verbündeten Frankreichs zusammen mit Teilen der französischen
Truppen bei Dünkirchen ins Meer getrieben wurden und die Atlantikküste
in deutscher Hand war.
Was
entlang der Heerstraßen ablief, beschreibt der folgende Bericht.
|
|

|
|
Während
im Artois und in Flandern Ende Mai (1940)
das Schicksal der dort eingekesseltenfranzösischen und englischen
Heeresteile sich zu entscheiden begann, hatte eine starke Kampftruppe des
deutschen Westheeres den doppelten Auftrag, die von Abbeville nach
Ost-Südost laufende deutsche Südfront zu halten und sich gleichzeitig
auf den bevorstehenden neuen Gewaltstoß in südlicher Richtung
vorzubereiten. Zu ihr gehörte unter den zahllosen Truppenteilen eine
Division, die bei Amiens im Kernpunkt der deutschen Abwehrfront ihre
doppelte Aufgabe vorausschauend und richtig auffassend, den Brückenkopf
bei Amiens für die kommende Kampfhandlung nach Süden erweitert
hatte; sie sah sich seit dem 27. Mai von einem erbitterten Angriff des
Gegners angefallen.
Trotzdem
die Franzosen mit überaus starken Kräften angriffen und an einer Stelle
über fünfunddreißig Panzerwagen gegen ein einziges deutsches
Infanterieregiment angesetzt hatten, wurde der Stoß zurückgeworfen und
unter Einsatz der gesamten eigenen Artillerie, der Flak und der
Panzerjäger mit erheblichen Verlusten für den Gegner abgeschlagen.
Immerhin hatten diese Kämpf ein Vorspiel dessen gegeben, was nun folgen
sollte: Es wurde klar, dass die Franzosen, in der Erkenntnis, dass es ums
Letzte ging, nun alle äußerste Kraft zusammennahmen, um den erwarteten
deutschen Stoß mit härtestem Widerstand aufzuhalten. Dementsprechend
waren drüben die Vorbe- reitungen, deren Bedeutung und kämpferischen Wert
die deutsche Truppe allerdings im Verlaufe des Kampfes selbst erst
erkennen konnte.
Handelte
es sich doch bei der französischen Verteidigung um die kilometerweit in
die Tiefe gegliederte Weygand-Linie, die der deutschen Südfront
gegenüber liegend, die französische "Siegfried-Stellung"
bedeutete und von deren erfolg- reicher Verteidigung schließlich das
Schicksal des Krieges und des Landes abhing. |
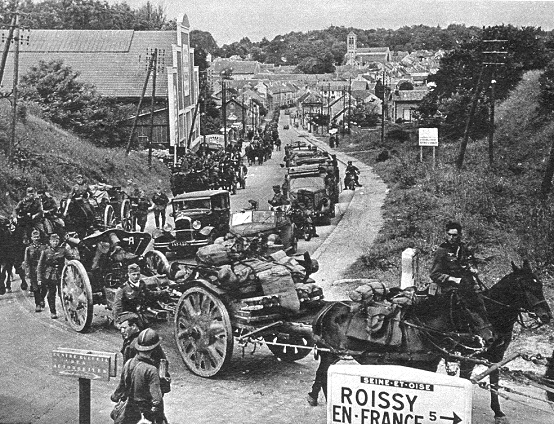
Unaufhaltsamer
Vormarsch über die Straßen Frankreichs, durch seine Dörfer und Städte;
über seine Höhen und seine Flüsse rollt in ununterbrochener Kette das
deutsche Heer, folgt bis in die vorderster Front der Nachschub. |
Der
französische Oberbefehlshaber General Weygand hatte in Auswertung der erst im
Mai gemachten Kriegserfahrungen aus Belgien die bevorstehenden Kampfhand- lungen
bewusst in die Dörfer und Ortschaften und damit in die Straßen selbst gelegt:
Durch nachdrückliche Befestigung der Fermen und Dorfstätten, der
Gehöfte und Waldstücke hatte er so ein Verteidigungssystem geschaffen, dessen
Durchbrechung an die deutschen Angriffstruppen allerletzte Anforderungen stellen
musste. Im Laufe des Kampfes sollte sich sehr bald zeigen, welch große Meister
die Franzosen gerade in der Kunst der Verteidigung und Befestigung sind, und
dass den deutschen Truppen an Schärfe des Einsatzes und an hartem Willen nichts
erspart blieb, wenn sie trotz der geschickten und umfassenden
Verteidigungsanlagen des Gegners auch hier wieder Sieger bleiben sollten.
|
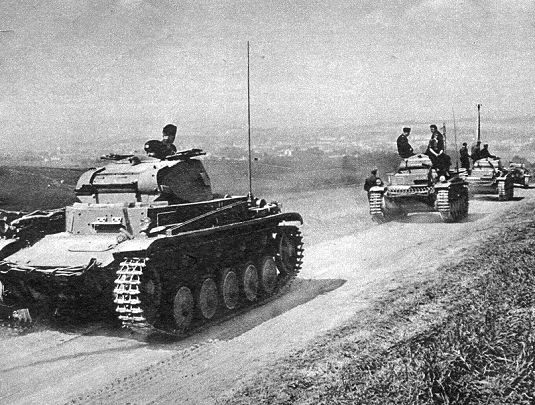
Der
Schrecken des Feindes, unsere Panzerkampfwagen, die tief in seine Front
einbrachen, ihn zurückwarfen, so dass schließlich sein Rückzug zur
Flucht wurde, rattern über das graue Band staubiger französischer
Landstraßen und Feldwege. Sie waren es, die der Infanterie den Weg über
die stärksten Widerstandsnester bahnten. |

Unsere
unvergleichliche Infanterie vollbrachte in Staub und Hitze gewaltige
Marsch- leistungen. War der Feind nach nach erbitterter Gegenwehr geworfen
und die Panzerspitze zusammen mit den schnellen Truppen vorausgeeilt, so
folgte unsere Infanterie in Gewaltmärschen und mehrmals konnte der
OKW-Bericht ausdrücklich betonen, dass sie in kurzer Zeit Anschluss an
die Panzerspitzen gefunden hatten. |
In
den Morgenstunden des 5. Juni brach der neue deutsche Angriff los. Unter
Einschiebung von Panzerdivisionen, deren Durchbruchsaufgabe klar war, hatten
die Infanterie- Divisionen die Hauptlast des Kampfes zu tragen, der sofort nach
dem Antreten sehr erbitterte und blutige Formen annahm. Nach kürzester, aber
stärkster Artillerievorbereitung durch die Division aus dem Brückenkopf von
Amiens rückte man vor und sah sich sehr schnell der neuen französischen Verteidigung
in einer Kampfesweise gegenüber, die mit besonderen Mitteln gebrochen werden
musste. Ging doch die Anweisung des Generals Weygand dahin, die den Widerstand
in offenem Gelände meist schnell überwindenden deutschen Panzerregimenter
durchzulassen und dann den unberührt gebliebenen, aber von den Franzosen auf
das geschickteste befestigten und auf das heftigste verteidigten Dörfern,
Höfen und Wäldern aus den Durchbruch der gesamten deutschen Angriffstruppe
schließlich zu brechen. Bereits unmittelbar vor der Sturmausgangsstellung traf
die Division daher auf erbittersten Widerstand in den Dörfern Dury und St.
Fuscien dicht südlich Amiens. Der Gegner wehrte sich hier beim ersten Ansturm
gegenüber auf das stärkste und ein Gehöft am Südausgang vo Dury, welches wie
all diese Dörfer in der Weygand-Linie durch schwere Barrikaden, zahlreiche
Tretminen und eine Unzahl von flankierenden Maschinengewehren, durch
Nahkampfgeschütze und eine tapfere Besatzung besonders widerstandsfähig
ausgebaut worden war, hatte diesen Stützpunkt so stark gemacht, dass es erst
des Einsatzes von besonderen Infanteriestoßtruppen und von Flammenwerfern
bedurfte, um den Widerstand zu brechen.
Stunden
vergingen darüber und während zwischen diesen und anderen Dörfern der
Weygand-Linie andere Einheiten der Angriffstruppe sich zwar vorarbeiteten, aber
dem flankierenden Feuer der Dörfer immer wieder liegen blieben, zischten immer
noch aus den Schießscharten der dicken Hofmauern jener Ferme die feindlichen
MG-Garben in den deutschen Angriff hinein. Erst nach langem und heißem Kampf
gelang es, den sich besonders erbittert schlagenden Gegner durch völlige
Vernichtung zu beseitigen. Damit hatte die Division ein Stück aus dem
Hauptkampffeld der Franzosen herausgebrochen und an dieser Stelle eine Bresche
geschlagen.
Befehlsgemäß
nach Südosten abschwenkend, stand die Division am folgenden Tag vor der
gleichen Aufgabe. Das Landstädtchen Boves mit den anliegenden
Waldstücken bot erneut heftigen Widerstand, und um die in der Nähe liegende
Cambos-Ferme entspannten sich erbitterte Kämpfe, deren Heftigkeit durch die mit
großem Geschick ausgebauten französischen Stürzpunkte noch vermehrt wurde.
Hier wie fast überall hatten die Franzosen eine oder mehrere leichte Batterien
dicht hinter oder vor dem Dorf offen, aber gut getarnt aufgestellt, sie mit
reichlicher Munition versehen und die französische Artillerie, an sich schon
immer gut und durch die Wendigkeit vom Weltkrieg her bekannt, leistete sehr
erheblichen Widerstand, so dass es abermals des gesamten Willens und der
entschlossenen Tatkraft der deutschen Regimenter bedurfte, um auch dieses
Bollwerk schließlich zusammenzuschlagen und zu nehmen. Unter nicht
unerheblichen Verlusten war es schließlich gelungen. Wo aber der deutsche
Angriff den Erfolg nach heftigem Kampf gebracht hatte, hatte der
Franzose zuletzt alles stehen und liegen lassen und reiche Beute war der
Angriffstruppe in die Hand gefallen. Doch sah sie sich, selbst mitgenommen von
der blutigen Arbeit und in die Tiefe der Weygand-Linie immer weiter hinein
stoßend, am nächsten Tag der gleichen Aufgabe gegenüber.
|
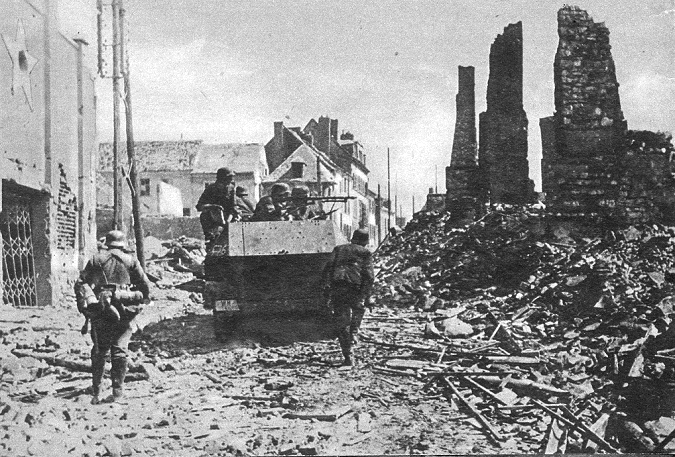
Feuerspeiende
Städte lagen auf der gesamten Angriffsfront unserer Truppen. Der
überlegene Angriffsgeist unseres Heeres durfte in diesem "Krieg an
den Straßen" auch dann nicht scheitern, wenn der Franzose bis zur
letzten Konsequenz Stadt und Dorf verteidigte. Wenn so Dutzende von
Dorfstätten in Brand aufgingen und in Trümmer fielen, so ist das eine
Schuld, die Frankreich allein tragen muss. |

Kampf
um Dörfer und Ortschaften. In Auswertung der im Mai gemachten Kriegs-
erfahrungen aus Belgien hatte der französische Oberbefehlshaber
General Weygand die Kampfhandlungen bewusst an die Straßen und damit in
die Dörfer und Ortschaften gelegt. An der Straße sollten die deutschen
Angriffsdivisionen zerschellen. Trotz härtesten Widerstands wurde das
Schicksal Frankreichs nicht aufgehalten- |
Über
Remiencourt, Dommartin und Moreuil brach die Division am
nächsten Tag immer weiter in das französische Verteidigungssystem hinein, um
immer wieder aus Dörfern und Waldstücken von heftigstem Feuer empfangen zu
werden und sich einem Widerstand gegenüber zu sehen, der an Härte nicht
abnahm, sondern bei dieser und anderen Divisionen der deutschen Angriffstruppe
an Stärke immer noch zuzunehmen schien. Die Entscheidung hier, wo die Truppe
fühlte, durch der Durchstoß durch die Befestigungslinie der feuerspeienden
Dörfer vor dem Erfolg stand, brachte erst ein Regiment, das noch an der Somme
zwischen Amiens und Corbie gestanden hatte und nach Durchbrechung und
Überwindung der dortigen befestigten Dörfer den Anschluss an die Division in
südwestlicher Richtung wieder suchte. Es sah die Not drüben, es sah die
brennenden Dorfstätten, es wusste um den erbitterten Widerstand, der sich
längs der Straßen in südlicher Richtung noch zu verstärken schien, und
obwohl alle Flussübergänge zerstört waren, marschierte dieses Regiment, ohne
Rast und ohne Fahrzeuge , die Maschinengewehre, die Granatwerfer und die anderen
Infanteriewaffen in der Hand und auf dem Rücken mit sich schleppend, auf den
Brennpunkt des Kampfes zu. Der Gegner hielt diesen Stoß nicht mehr aus. Im
blutigen, auch nächtlichen Häuserkampf ward er hier geworfen und nun machten
sich, nachdem der deutsche Angriffsschwung erst richtig zur Auswirkung gekommen
war, drüben die ersten Zeichen der Auflösung sichtbar.
Die
unerwartete Stoßkraft der deutschen Regimenter, die es fertiggebracht hatten,
auch die festen und so nachhaltig verteidigten Stützpunkte der Weygand-Linie zu
durchbrechen, die, auf den Straßen sich vorwärts kämpfend Dorf um Dorf
schließlich in ihre Hand brachten, hatte die Widerstandskraft der französischen
Truppen schließlich zermürbt. Der Rückzug der französischen Armeen, die die
Weygand-Linie unter allen Umständen hatten halten sollen, begann, er artete
bald in Flucht aus, die Gefangenzahlen mehrten sich und währen die deutsche
Artillerie das Hintergelände, fernliegende Dörfer und die Rückzugsstraßen
mit schwerem Feuer belegte, fand man bereits in den nächsten Tagen einzelne
Orte vollgestopft mit zurückgelassenen französischen Fahrzeugen, mit noch
geladenen Geschützen und mit einer Unmasse von fortgeworfenen Gerät- und
Ausrüstungsstücken.
Wohl
wechselten immer wieder Angriff und Verfolgung, und in zahlreichen, oft
mehrfachen täglichen Marschgefechten wurden die südlich liegenden, nun schnell
abermals zur Verteidigung hergerichteten Dörfer und Gehöfte genommen, aber die
Tatsache der Durchbrechung der Weygand-Linie ließ den Widerstand des Gegners
erlahmen. In zahllosen langen Kolonnen auf den Straßen vorwärts marschierend
und fechtend, brach die deutsche Angriffstruppe nach Süden sich Bahn und
erreichte schon in den nächsten Tagen das Dorf Maignelay. Motorisierte
Vorausabteilungen jagten hinter dem Feind her, der wichtige Oise-Übergang
von Creil wurde in nächtlichem Häuserkampf genommen, ein Brückenkopf
gebildet, man drang in den Wald von Chantilly ein, und so stand die
Angriffsdivision von Amiens bereits am siebten Angriffstag in der
Gegend von Senlis vor der Schutzstellung von Paris, die der
Franzose, weil er anders nicht mehr konnte, nun vor dem beabsichtigten deutschen
Angriff räumte.
Er gab Paris damit auf!
Es
hatte alles nichts genutzt. Die Tapferkeit der französischen Soldaten, die der
Führer
dem französischen General in der Präambel der Waffenstillstandsbedingungen in Compiègne
ausdrücklich bestätigen ließ, war groß gewesen,
ihre Standfestigkeit gut und ihr Widerstand war mit äußerster Härte
durchgeführt worden. So bleibt es ein besonderes Ruhmesblatt der deutschen
Divisionen, dass sie auch in der neuen Kampfesweise, die man "den Krieg auf
den Straßen" nennt, siegreich blieben. Wohl hatten die Franzosen erkannt,
dass der Ausbau erkennbarer Stellungslinien im heutigen Blitzkrieg und bei der
Überlegenheit der deutschen Luftwaffe nicht mehr angewandt werden konnte.
|

Das
blieb übrig!
Feindliche
Panzerabwehrkanonen, die den Vorstoß unserer Panzerkampfwagen aufhalten
sollten, wurden zermalmt. |
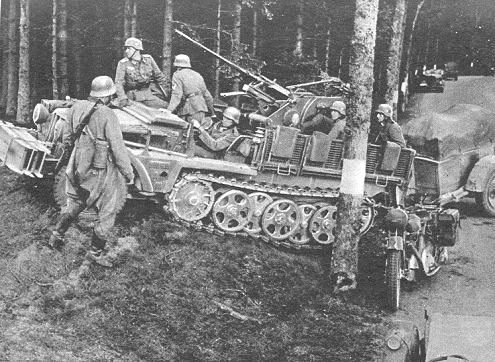
Den
Schutz der Straße übernehmen Flak, Panzerabwehrgeschütze und andere
artillerietechnische Waffen. In den ersten Tagen der Offensive, als die
Luftwaffe des Feindes noch nicht gänzlich vernichtet war, erfolgten immer
wieder Bomben- angriffe, die den Aufmarsch unserer Truppen stören
sollten. Die Angriffe des Feindes brachen an allen Stellen im Abwehrkampf
unserer Waffen zusammen. |
Ingrimmig
um die Verteidigung ihres Landes bemüht, verlegte die französische Führung
den letzten und entscheidenden Kampf an die Straßen und in die Dörfer, und
wenn so ungezählte Dutzende von Dorfstätten in Flammen aufgingen und in
Trümmer fielen, so ist das eine Angelegenheit, die Frankreich allein tragen
muss. Wesentlich allein bleibt hier die Feststellung, dass die neue Kampfesweise
der Franzosen von der deutschen Führung und der deutschen Truppe schnell
erkannt, dass alle Folgerungen gezogen und alles getan und hergegeben wurde, um
die Überlegenheit des deutschen Angriffs auch hier, im "Krieg an den
Straßen", nicht scheitern zu lassen. Mit beispielloser Wucht warfen sich
die deutschen Infanterieregimenter, oft unterstützt durch die Bresche
schlagenden Stuka-Geschwader, den flammenspeienden Dörfern entgegen, mit
größter Treffsicherheit bekämpfte die Artillerie den Widerstand, mit
unbändigem Schneid drangen die Stoßtrupps der Infanterie und der Pioniere in
die feuersprühenden Festungen ein, und Dorf um Dorf fiel so nach meist heftigem
Häuserkampf doch in die Hand der deutschen Truppen.
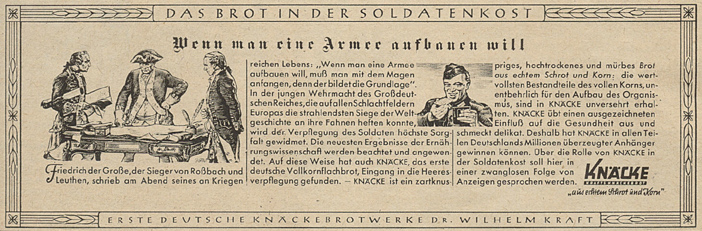
Der
Kampf hatte nicht unwesentliche Verluste gekostet, aber auch dieser Feldzug war
bereits am dritten Tage mit der Durchbrechung der Weygand-Linie gewonnen und der
Einmarsch und Durchzug durch Paris gaben den siegreichen deutschen Regimentern
jene Anerkennung ihrer Bewährung, die der Soldat braucht, wenn er nach so
hartem und blutigen Kampf gegenüber einem tapferen Gegner das Ziel erreicht
hat.
|

Der
Krieg raste über diese Straße, zerschmetterte Nachschubkolonnen,
vernichtete Artilleriestellungen. Tausende und Abertausende von
Ausrüstungsgegenständen zeichnen den Weg der geschlagenen Armee eines
Landes, das in blindem Vertrauen auf britische Hilfe und in verblendeter
Selbstüberhebung dem Deutschen Reich den Krieg erklärte. |

Unter
der Straßendecke lauert der Tod. Überall hat der Feind über die
Straßen verstreut Minen aller Art und Größe gelegt. Unsere Pioniere
machen diese Minenfelder der Straße unschädlich, damit die Kolonnen der
LKW und PKW, damit die marschierende Infanterie ohne Gefahr ihren Weg
weiter nehmen können. |
|
Der
Tod spricht seine eigene Sprache
Man
findet nicht selten in den Heften "Die Wehrmacht" Bilder, wie
die unten stehenden. Sie zeigen Gräber am Wegesrand, für die genügend
Zeit bestand, sie auszuheben und die Kameraden angemessen zu bestatten.
Man kann sich allerdings leicht vorstellen, was nach dem Krieg aus den
Gräbern am Feldesrand wurde. Auf der anderen Seite überrannten die
Kampfeinheiten immer wieder Mensch und Tier, die dann oft wochenlang
verwesend am Straßenrand lagen oder gar von den folgenden Fahrzeugen
platt gefahren wurden. Beide Bilder entstanden in Polen, das innerhalb
weniger Tage überrannt worden war.
|
|
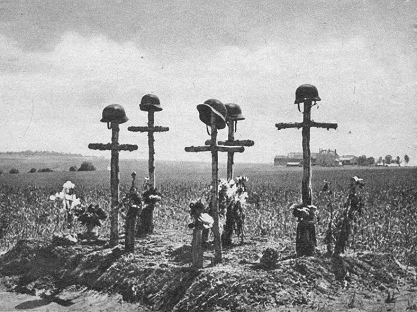
|

|
 |
Werben
um Eisenbahnpioniere zu Kriegsbeginn
Im
Januar 1939, als in Erwartung schwerer militärischer Auseinandersetzungen
kräftig aufgerüstet wurde, musste auch eine Truppe aufgestellt werden,
die die für Truppenverlegungen und den Nachschub so wichtigen Bahnlinien
pflegen und bei Zerstörung wiederherrichten sollten. Weil im Ersten
Weltkrieg gerade diese Truppe Besonderes geleistet hatte und praktisch
unverzichtbar war, griff man auf die Erfahrungen, die bewährten
Strukturen und die noch vorhanden Kräfte zurück, um eine neue
schlagkräftige Truppe aufzubauen.
Der
nachfolgende Bericht setzt deshalb auf den Verdiensten von vor 1939 auf
und war als Werbung für diesen Truppenteil gedacht. Man versuchte, allen
benötigten Bevölkerungs-Gruppen je nach Befähigung die Eisen-
bahnpioniere schmackhaft zu machen.
Als
später europaweit die Zerstörungsmaschinerie angelaufen war, wuchs die
Truppe gewaltig an und musste praktisch an allen Fronten die Feuerwehr
spielen. Teile der Truppe hatten auch andere Aufgabengebiete, wie den
Bunkerbau und die Zerstörung von Bahnanlagen auf einem möglichen
Rückzug. Dabei waren die Soldaten permanent Angriffen regulärer Truppen,
aber auch von Saboteuren und Partisanen ausgesetzt.
Als
gegen Ende des Krieges die Befehle "verbrannte Erde" erteilt
wurden, hielten die Eisenbahnpioniere mit dem Verminen und Zerstören von
Bahnanlagen und Straßen ganz wesentlich den Feind auf und verschafften
dem mehr oder weniger geordneten Rückzug die benötigte Luft.
Eine
der herausragenden Arbeiten war übrigens die Seilbahn übers offene Meer
von der Halbinsel Kertsch zum festen Teil des Kuban-Brückenkopfes, mit
der neben Ausrüstung auch die Verwundeten transportiert wurden. Man
rettete so Tausende von Soldaten. Eisenbahnpioniere waren nebenbei auch
echte Haudegen, die sich tapfer schlugen, wenn sie in Kämpfe verwickelt
wurden. |
|
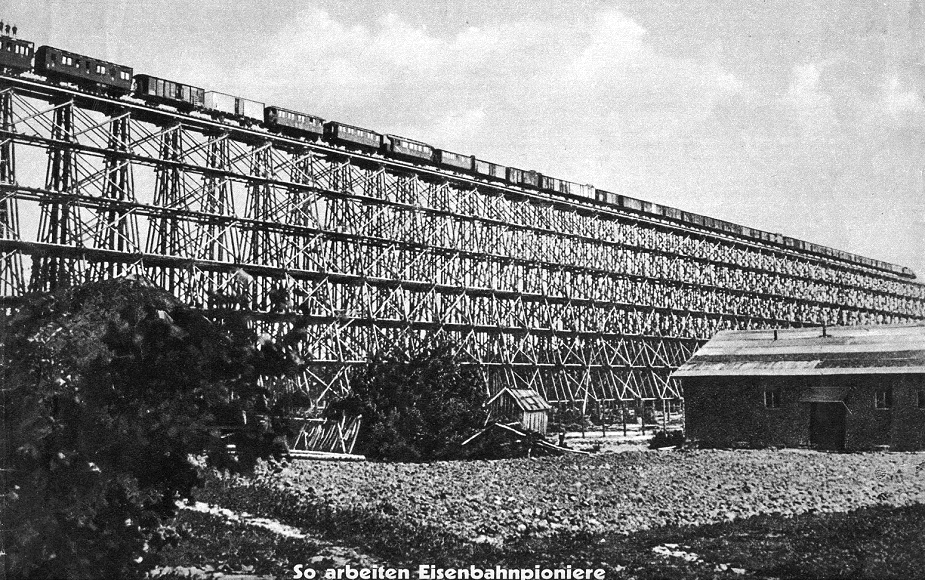
Im
Weltkrieg wurde diese 500 Meter lange hohe Brücke über den Njemen von 4
Kompanien in 10 Wochen erbaut. |
|
Von
Hauptmann Lange
Inspektion
der Eisenbahnpioniere im Oberkommando des Heeres
(Die
Wehrmacht, 3. Jahrgang, Heft Nr. 2 vom 18.01.1939)
|
Als
vor einem Monat die feierliche Vereidigung der Rekruten des ersten
Regiments der nach 20 Jahren wiedererstandenen Eisenbahntruppe stattfand,
als dem Regiment vom Inspekteur der Pioniere, Eisen- bahnpioniere und
Festungen die vom Führer verlie- henen Standarten übergeben wurden, da
erwachte mit einem Schlag die Erinnerung an jene Regimenter, die im
Weltkrieg Hervorragendes geleistet haben. Die alten Regimentsfahnen in den
schwieligen Händen der jungen Soldaten des neuen Heeres flatterten im
Wind, als brächten sie den Gruß einer unvergesslichen ruhmreichen Truppe
der alten Armee, deren Gruß ihrer gefallenen Helden. Die alte
Eisenbahntruppe hatte im Jahre 1918 aufgehört zu bestehen, das
Schanddiktat von Versailles zerschlug sie zusammen |
mit
anderen Spezialtruppen. Eine schlagkräftige Waffe sollte der Deutschen
Nation genommen werden.
Im
Jahre 1871 hatte der damalige Generalstabschef, Generalfeldmarschall Graf
von Moltke, die Aufstellung von Eisenbahntruppen gefordert, als er mit
weitschau- endem Blick den Eisenbahnen die zukünftige hohe Bedeutung für
die Kriegsführung voraussagte.
Bei
Ausbruch der Mobilmachung 1914 bestanden die 1. Eisenbahnbrigade (Eisb.Rgt.
1 und Eisb.Batl. 4) in Berlin-Schöneberg, die 2. Eisenbahnbrigade (Eisb.
Rgt. 2 und 3) in Hanau, das bayerische Eisenbahn- bataillon in München
und die Direktion der Militär- Eisenbahn mit der Betriebsabteilung.
Die
im Frieden vorhandene Eisenbahntruppen bildeten |
die
Stämme für die zu Kriegsbeginn aufzustellenden Eisenbahnbauformationen
in der Stärke von
30
Eisenbahnbaukompanien
26
Reservebaukompanien
7 Landwehrbaukompanien
11
Festungsbaukompanien und
4 Eisenbahnarbeiter-Bataillone
(später Eisenbahnhilfsbataillone genannt)
Die
Jahrhundertwende hatte bereits die junge Eisen- bahnpioniertruppe vor die
ersten großen Aufgaben gestellt.1900 bis 1901 wurden sie im fernen Osten
eingesetzt, als es galt, die von den Chinesen zerstörte Verkehrslinie
Yangtun-Peking wiederherzustellen. |
|
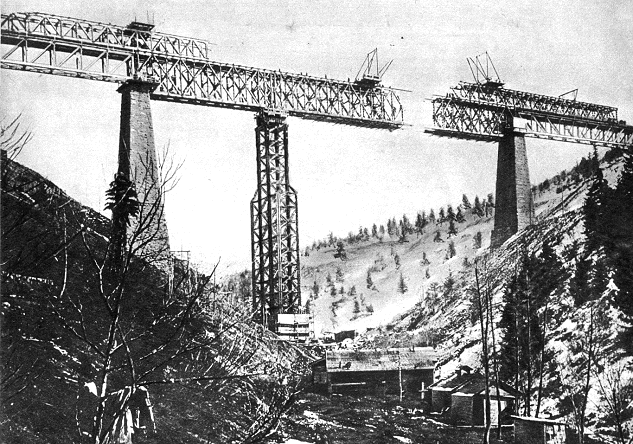
Wiederherstellung
eines in Siebenbürgen während der Kämpfe um Rumänien im Weltkrieg
zerstörten Viadukts. Die Arbeiten wurden von den damaligen
Eisenbahntruppen in schwindelnder Höhe von 64 Metern ausgeführt.
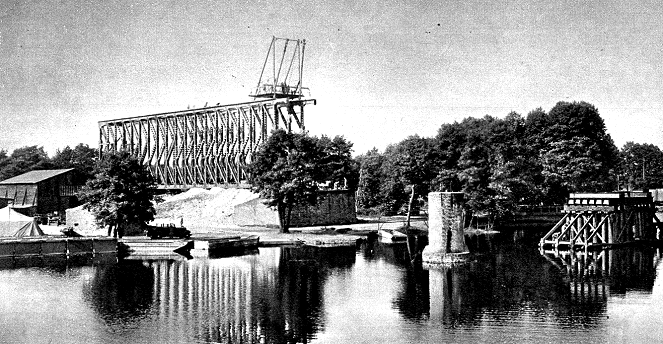
DEr Bau schwerster
Eisenbahn-Kriegsbrücken ist die Krönung der Arbeit der
Eisenbahnpioniere. Die nachfol- genden Bilder zeigen den Bau einer
dreistöckigen Kriegsbrücke auf dem Übungsplatz eines Eisenbahnpionier-
regiments. An der Bauspitze steht ein Laufkran für die Bewegung und das
Einsetzen der schweren Träger. Der in das Flussbett eingelassene aus Holz
und Stahl konstruierte Brückenpfeiler, den das Bild unten rechts in
Vergrößerung zeigt, hat eine Tragfähigkeit von über 100 Tonnen |
Im
Jahre 1904 brach der Hereroaufstand aus, der auch die Eisenbahnpioniere
nach Deutsch-Südwestafrika rief. Hier gab es Arbeit in Hülle und Fülle,
denn die Strecke Swakopmund-Windhuk war dem Erdboden gleich- gemacht, eine
320 Meter lange Landungsbrücke vor Swakopmund musste gebaut, neue Wege
mussten erschlossen und zahlreiche Wasserstellen erbohrt werden.
Dann
kam der Weltkrieg mit seinen ungeheuerlichen von Jahr zu Jahr sich
steigernden Anforderungen, beeinflusst in besonderem Maße von zwei
Faktoren, von Masse und Technik. Die Auswirkungen ersieht man daraus, dass
am Ende des Weltkrieges 442.000 Mann dem Feldeisenbahnhof unterstellt
waren. Große Aufgaben waren zu erfüllen, es galt, zerstörte Strecken
und Brücken wiederherzustellen, neue Strecken zu bauen und umgekehrt
Zerstörungen jeglicher Art durch- zuführen. Die Zeit bedingte die
Aufstellung von Spezial- einheiten, wie Unterwasserschneidekommandos,
Brunnenbohr-, Seilbahnbau- und -betriebsabteilungen, Maschinenparks,
Werkstätten, Depots, Holzfäller- und Bergbaukompanien u.a.m..
Unerhörte
Leistungen wurden erzielt, vom einfachen Umnageln der Spur bis zum
schwersten Brückenbau, ganz gleich, ob behelfsmäßig oder aus
vorbereitetem Kriegsbrückengerät. Bis zum Mai 1916 kamen allein auf dem
östlichen Kriegsschauplatz an Brückenbauten für Vollbahn (Feldbahnen
und Kleinbahnen nicht mitgerechnet) zusammen rund 35 Kilometer Brücke zu
Ausführung, das bedeutet für die 500 Tage Krieg bis dahin eine
Tagesleistung von 70 Meter fertiger Brücke!
Dazu
waren in der selben Zeit auf russischem Boden allein 1100 Kilometer
Vollbahnen, d.h. eine Strecke von Köln bis Königsberg/Pr. neu gebaut
worden.
Die
Leistungen der Eisenbahntruppe im Weltkrieg hat kein geringerer als
Generalfeldmarschall von Hindenburg als "hervorragend"
bezeichnet. Die Opferbereitschaft der Truppe findet ihren Niederschlag in
der Verlustliste, nach der 152 Offiziere und 3138 Unteroffiziere und
Mannschaften, das ist über drei Viertel des Friedensbestandes, im
Weltkrieg auf dem Feld der Ehre geblieben sind.
Unserem
Führer ist es zu danken, dass durch die Wiederherstellung der Wehrhoheit
und die machtvolle, mit allen Waffen der Neuzeit erfolgte Ausgestaltung
der Armee auch die Eisenbahnpioniertruppe wieder ins Leben gerufen werden
konnte. Sie bietet jungen Leuten, die aktive Truppenoffiziere werden
wollen, beste Aussicht auf Vorwärtskommen, vorausgesetzt, dass neben der
selbstverständlichen soldatischen Passion, einer uneingeschränkten Lust
und Liebe zum Offiziers- beruf und vollen Hingabe an den Dienst ebensoviel
Talent und Verständnis für die technische Truppe, wie überhaupt für
die Technik im allgemeinen, mitgebracht werden. |
 |
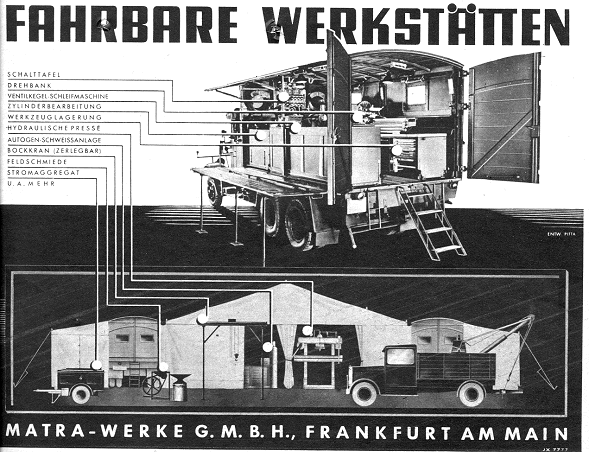
|
Die
Eisenbahnpioniertruppe ist eine hochwertige technische Bautruppe, die, wies so
oft angenommen, mit Eisenbahnbetrieb so gut wie nichts zu tun hat. Die
Regimenter erhalten die allgemeine militärische Ausbildung im Exerzieren,
Schießen und Gefechtsdienst und im allgemeinen technischen Dienst wie Spreng-,
Sperr- und Wasser- dienst wie die Pioniere. Daneben läuft die Ausbildung im
Eisenbahnbau und im Bau schwerer und schwerster Brücken für sämtliche in
Deutschland vorkommenden Verkehrslasten, d.h. Lasten bis zu den schwersten und
modernsten Lokomotiven. Gerade der schwerste Brückenbau adelt die Arbeit der
Eisenbahnpioniere. Hier gilt es, ein Offizierskorps zu schaffen aus Männern mit
körperlicher und geistiger Eignung, mit Charaktereigenschaften und mit viel
Liebe und Passion zur Technik.
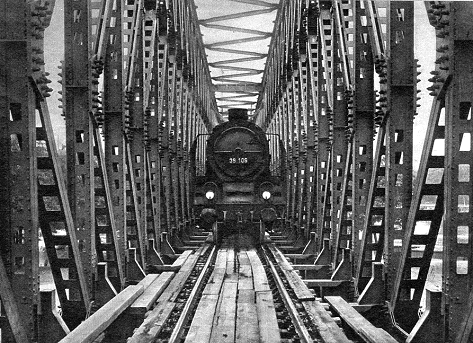
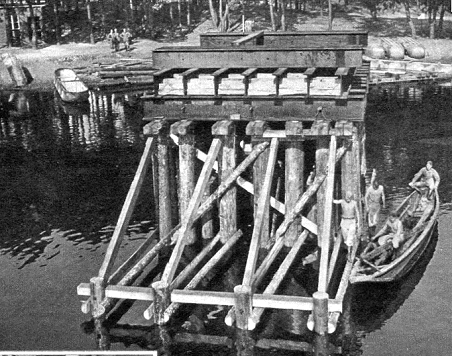
Bei
den Offizieren des Beurlaubtenstandes muss eine technische Veranlagung und
Fachausbildung als Bauingenieur oder Bautechniker vorausgesetzt werden, da
Nichtingenieure den technischen Anforderungen unmöglich gewachsen sein können.
Jungen Leuten, insbesondere Abiturienten, von denen die aktive Dienstpflicht
möglichst vor Beginn des Hochschulstudiums oder des Besuches höherer
technischer Lehranstalten erfüllt sein soll, wird angeraten, sich vorzeitig als
Freiwillige zu melden. Sie haben den Vorteil, dass sie vor dem Zeitpunkt der
Aushebung ihres Geburtsjahrganges vorzeitig ihre zweijährige aktive
Dienstpflicht zu einem Zeitpunkt erfüllen können, der ihnen für ihre spätere
berufliche Aus- und Weiterbildung erwünscht ist; zum anderen können sie sich
ein Eisenbahnpionierregiment wählen, bei dem sie dienen möchten. Solchen
jungen Leuten, die einen bautechnischen Beruf anstrebe, bieten sich bei
sonstiger Eignung gute Aussichten, Reserveoffizier der Eisenbahnpioniere zu
werden.
|

Einsatz
der Eisenbahnpioniere beim Einmarsch ins Sudetenland: In großer zahl
waren von den Tschechen kleine Eisenbahnbrücken zerstört worden... |

...die
in kurzer zeit von unseren Truppen unter kräftigem
"Hau-Ruck"... |
Fachhandwerkern
bietet sich bei der Eisenbahnpioniertruppe beste Gelegenheit für ihre spätere
berufliche Aus- und Weiterbildung. Es sei zum Schluss darauf hingewiesen, dass
die Merkblätter: "Der Offiziersnachwuchs des Heeres" und
"Merkblatt für den Eintritt als Freiwilliger in das Heer" bei dem
für den dauernden Aufenthalt des Bewerbers zuständigen Wehrbezirkskommando
bzw. Wehrmeldeamt zu erhalten sind, bei dem auch die Vorlage des Annahmegesuches
als Freiwilliger zu erfolgen hat. Bewebungsgesuche zwecks Einstellung als
Fahnenjunker bei der Eisenbahnpioniertruppe können nur gerichtet werden an den Kommandeur
des Eisenbahnpionierregiments 68, z. Zt. in Rehagen-Klausdorf, Krs. Teltow und
an den Kommandeur des Eisenbahnpionierbatallions 56 in Kornenburg a.d. Donau bei
Wien.
|
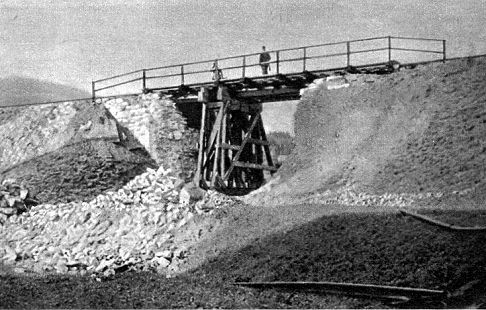
...vorschriftsmäßig
durch Holz- und Stahlverstrebungen wiederhergestellt wurden |
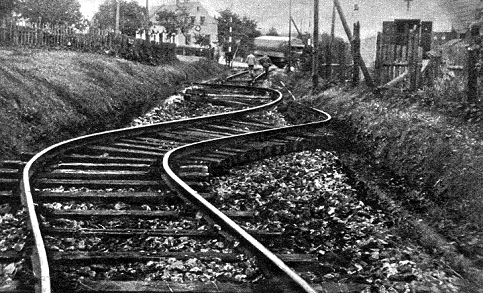
Zahlreiche
Grenzstrecken hatten die Tschechen durch Gleisaufreißmaschinen zerstört.
Das alte Material war dadurch völlig unbrauchbar geworden und die
Strecken mussten neu gelegt werden. |
|
Rolle
der Wirtschaft in der Rüstung
Zu
Beginn des Jahres 1940 wurde die Rolle der Wirtschaft bei den
Kriegsvorbereitungen und damit die Leistungsfähigkeit der
Rüstungsindustrie gepriesen. Man machte das in der Absicht, die
ehemaligen Kriegsgegner des Ersten Weltkriegs zu beeindrucken. Es war
nämlich gelungen, Deutschland mit tatkräftiger Hilfe der Wirtschaft wieder
aufzurüsten. Die Vierjahrespläne waren so aufgebaut, dass man unschwer
die Absicht erkennen konnte. Alle Zeichen standen auf Krieg und es war
klar, dass die Art der produzierten Waffen nicht viel mit einem Verteidigungskrieg zu
tun hatten. Der Industrie war auch klar, woher das benötigte Geld für
einen oder mehrere Kriege kommen sollte, das in ihre Taschen floss. Es mussten Siege her, mit deren
Hilfe man Länder unterwerfen und ausbeuten konnte. Polen war ein erstes
Beispiel, wenn hier auch nur Steinkohle und Stahl zu holen waren. Der
Polenfeldzug war als Generalprobe gedacht, die ja auch für das Militär und die Kriegsgewinnler überaus
erfolgreich verlief. Von den
vielen Toten auf beiden Seiten war kaum die Rede, denn das hätte nur in den Umsatz- und
Gewinnbetrachtungen der Industrie gestört, die Adolf Hitlers Pläne äußerst
bereitwillig umsetzten. Es war schnell klar, dass weitere
Beutezüge folgen sollten und der Blick ging bereits nach Westen.
|
 |
Bei
diesen Informationen ist fast unverständlich, wie arglos die späteren
Kriegsgegner dieser Kraftstrotzerei gegenüber standen. Man konnte genau
sehen, was passieren würde, auch wenn die Außenminister noch an eine
begrenzte Auseinandersetzung glaubten und eine weitere Ausdehnung des
Konflikts verhindern wollten.
In
den deutschen Fabriken lief alles wie geschmiert und es waren vor allen
Dingen logistische Meisterleistungen, die alle Kräfte zu bündeln
verstanden. Alles war von langer Hand vorbereitet und es ist absolut
undenkbar, dass die Industrie nicht eingebunden war. Sie stützte
ein System, das ihnen größte Gewinne in Aussicht stellte. Selbst wenn
das Regime scheitern sollte, hätten sie alle ihr Geld verdient. Hier zeigt
sich wieder die Parallele zur heutigen Situation. An allen Brennpunkten
der Welt werden Kriege geführt, bei denen immer die gleichen Branchen profitieren. Damals wie heute werden Politiker
deshalb kräftig unterstützt, wenn
sie den Verbrauch von Waffen und Munition garantieren. Ob es sich dabei um
Diktatoren in Afrika, dem Balkan, dem Orient oder US-Präsidenten handelt, Terroristen oder
Friedenstruppen - immer ist die Industrie dabei und verdient kräftig mit. Der
Blick ist dabei vor allen Dingen auf Rohstoffe gerichtet, die es als
Handlanger der Sieger billig zu
erwerben gilt. |
Unsere
Rüstungsindustrie an der Spitze
("Die
Wehrmacht", 31. Januar 1940)
Heute
weiß jeder Soldat an der Front und jeder Volksgenosse in der Heimat, dass ein
moderner Krieg nicht nur eine militärische Auseinandersetzung, sondern auch ein
wirtschaftlicher Kampf größten Ausmaßes ist. Es liegt ein gutes Stück
Wahrheit in den Worten eines französischen Generals, der den Krieg unserer Tage
als "Krieg der Fabriken" bezeichnet hat.
Dem
Krieg gewaltiger Millionenarmeen an den Fronten steht der Aufmarsch der
Industrien im Hinterlande gleichbedeutend zur Seite; denn ohne eine
hochleistungsfähige Industrie, die der Wehrmacht Waffen und Munition aller
Gattungen in unbeschränktem Maße zur Verfügung stellt, ist das tapferste Heer
letzten Endes zur Ohnmacht verurteilt. Umgekehrt gibt eine hohe industrielle
Kriegsbereitschaft und Leistungsfähigkeit den Armeen die Waffen in die Hand,
die ihnen die Möglichkeit und die Kraft zur Erringung des Sieges verleiht.
Der
deutsche Soldat kämpft heute in dem sicheren Bewusstsein, dass ihm die
Waffenschmiede in der Heimat all das Kriegsmaterial liefert, das er für die
Verteidigung der Sicherheit und der Ehre Deutschlands benötigt. Die deutsche
Industrie ist nämlich heute so stark und leistungsfähig wie nie zuvor. Dies
gilt sowohl hinsichtlich der eigentlichen Rüstungsindustrie, als auch
derjenigen Industriezweige, die erst im Ernstfalle auf die Herstellung von
Kriegsgerät umgestellt werden.
Der
Führer gab in seiner letzten großen Reichstagsrede bekannt, dass für die
Wehrhaftmachung des deutschen Volkes in den letzten sechs Jahren rund 70
Milliarden RM ausgegeben worden sind. In dieser gewaltigen Ziffer dokumentiert
sich die Leistungsfähigkeit der deutschen Rüstungsindustrie, natürlich
einschließlich der Produktionsgüter- und Rohstoffindustrie im weitesten Sinne.
Zum Vergleich sei noch erwähnt, dass sich die Rüstungsausgaben Englands in dem
gleichen Zeitraum auf 25 Milliarden RM und die Frankreichs sogar nur auf 15
Milliarden RM belaufen haben. Klarer vermag die Überlegenheit der deutschen
Rüstungsproduktion kaum in Erscheinung zu treten.
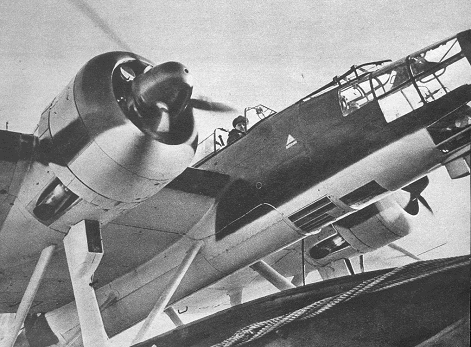 |
Besonders
groß ist der Vorsprung Deutschlands auf dem Gebiet des Flugzeugbaues.
Selbst in der ausländischen Presse wurde zugegeben, dass das Deutsche
Reich heute mehr - und bessere - Flugzeuge baut als Frankreich und England
zusammen genommen. Die britische und französische Luftfahrtindustrie sind
nicht in der Lage, den Bedarf ihrer Länder aus eigener Produktion zu
befriedigen. Die Regierungen der beiden Staaten sehen sich deshalb
gezwungen, bei der amerikanischen Flugzeugindustrie Bestellungen in
größerem Umfange zu tätigen. Unsere deutschen Flugzeugwerke haben
dagegen nicht nur unsere heutige gewaltige Luftflotte zu erstellen
vermocht, sondern sie haben darüber hinaus noch Flugzeuge für die
Ausfuhr produziert. Deutschland ist in Fluggerät zum führenden
Exportland Europas, wahrscheinlich sogar schon der Welt geworden.
Zur
rein zahlenmäßigen Stärke und Leistungsfähigkeit der deutschen
Luftfahrtindustrie kommt hinzu, dass die deutschen Flugzeuge auch
qualitativ die besten der Welt sind. In wenigen Jahren gelang es deutschen
Flugzeugkonstrukteuren, den Unterschied vom Rekordflugzeug zum
Jagdflugzeug hinsichtlich der Schnellflugleistung zu beseitigen. Am 5.
Juni 1938 stellte Generalleutnant Udet auf einem Jagd-Einsitzer mit 635
Kilometer pro Stunde einen neuen Weltrekord auf. Dieser wurde am 30. März
1939 von Flugkapitän Dieterle auf 746,66 Kilometer hinaufgeschraubt. Eine
Leistung, die in der ganzen Welt größte Beachtung hervorrief. Sie wurde
aber wenige Zeit später noch durch den phantastischen neuen Weltrekord
von Flugkapitän Wendel mit 755 km/h übertroffen. |
|
Es
ist aber nicht nur die eigentliche deutsche Rüstungsindustrie, die in der
ganzen Welt unerreichte Spitzenleistungen vollbringt. Auch die im weiteren
Sinne für die Kriegsgeräteerzeugung arbeitenden Industriezweige haben in
den letzten Jahren einen ungewöhnlichen Aufschwung genommen. Das ist
außerordentlich wichtig. Denn die im Kriege notwendige weiteste
Ausdehnung der Kriegsmaterialproduktion ist entscheidend abhängig von der
Größe und dem Zustand der sog. Produktionsgüterindustrie, d.h. also
insbesondere von dem Bergbau, der
Eisen- und Metallindustrie, der
chemischen und elektrotechnischen Industrie, dem Fahrzeugbau und dem
Baugewerbe.
Die
deutsche Rohstahlerzeugung erreichte im Jahr 1939 mit rund 23 Millionen
Tonnen einen alle früheren Produktionsjahre weit überragenden Stand. Mit
dieser Leistung übertraf sie beispielsweise die Rohstahlerzeugung
Englands, die sich 1938 auf 10,6 Millionen Tonnen stellte, um erheblich
mehr als 100 Prozent. Noch günstiger wird die deutsche Stahlerzeugung
durch die Besetzung polnischer Industriegebiete. Die deutsche Eisen- und
Stahlerzeugung erfährt dadurch eine Steigerung von weiteren 2 Millionen
Tonnen im Jahr. Dabei ist besonders zu bemerken, dass sich die polnische
Produktionsziffer unter deutscher Verwaltung noch ganz erheblich erhöhen
wird.
Die
für Rüstungszwecke so besonders bedeutungsvolle Maschinenindustrie hat
gleichfalls in ihrer Erzeugung eine Rekordhöhe erreicht. Ihr
Produktionswert stieg von 1,4 Milliarden RM 1932 auf 5,5 Milliarden RM im
Jahr 1938. Im Jahre 1939 wurde durch die Verlängerung der
durchschnittlichen Arbeitszeit und durch verschiedene Rationalisierungs-
und Ausbaumaßnahmen eine weitere Zunahme der Produktion erzielt. |
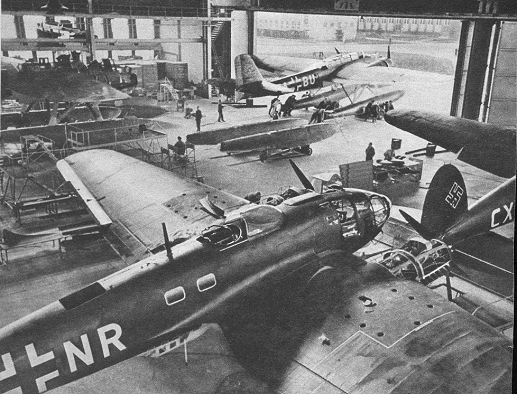 |

 |
Diese
Bilder wurden nicht nur in Deutschland veröffentlicht, sondern sie gingen
um die ganze Welt. Wer bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Bild war,
musste so langsam erkennen, welche Machtinstrumente Adolf Hitler in der
Hand hielt.
Natürlich
wucherte man mit dem Pfund, dass die Deutschen besonders kreativ, fleißig
und ideenreich seien. Man darf aber nicht vergessen, dass das alles nur
umsetzbar ist, wenn auch das Geld stimmt, das Deutschland eigentlich gar
nicht hatte. Man musste es sich also irgendwo her holen. Das Rezept hieß:
Eroberungskriege und Ausbeutung der Besiegten. Der Wirtschaft waren
bare Münze und kostenlose Arbeitskräfte willkommen. Beides wurde auf
grausame Weise beschafft und zur Verfügung gestellt. Man muss der
gesamten Wirtschaft vorwerfen, aktiv und treibend am Krieg beteiligt gewesen zu sein
und alles getan zu haben, um sich gewissenlos zu bereichern. |

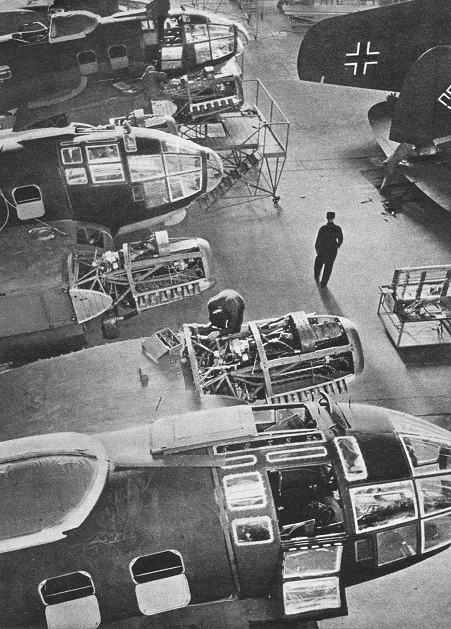
 |
Der
deutsche Steinkohlebergbau steht heute im Zeichen höchster Ausnutzung seiner
Kapazität. Während 1932 nur rund 105 Millionen Tonnen Steinkohle in
Deutschland gefördert wurde, betrug die Förderziffer 1938 186 Millionen
Tonnen. Ausgeführt wurden im Jahre 1938 25,7 Millionen Tonnen Steinkohle und
4,7 Millionen Tonnen Braunkohle. Durch die Besetzung Polens kommen zu den 186
Millionen Tonnen Steinkohlen der Altreichsproduktion noch 45 Millionen Tonnen
aus den oberschlesischen Gruben und aus anderen Revieren Polens hinzu.
Diese
wenigen Beispiele für den in den letzten sechs Jahren erfolgten gewaltigen
Aufschwung unserer industriellen Leistungsfähigkeit, die sich beliebig
erweitern ließen, mögen genügen. Sie zeigen mit aller Klarheit, dass
Deutschland heute neben seiner großartigen speziellen Rüstungsindustrie eine
Produktionsgüter- und Rohstoffindustrie besitzt, die die deutsche Wehrmacht im
gegenwärtigen Kriege mit erstklassigen Waffen und Kriegsgerät aller Art
ausreichend versorgen kann und wird. Die im Jahre 1939 erzielten
Produktionsergebnisse werden im Jahr 1940 im rüstungsindustriellen Sektor mit
Sicherheit übertroffen werden. Dafür bürgt einmal der Leistungswille und die
Kraft des deutschen Arbeiters und zum anderen unsere in Jahren aufgebaute
militärische und zivile Wehrwirtschaftsorganisation, die in den ersten vier
Kriegmonaten ihr Feuerprobe erfolgreich bestanden hat.
Heinrich
Hellmer, Dipl.-Volkswirt
 |
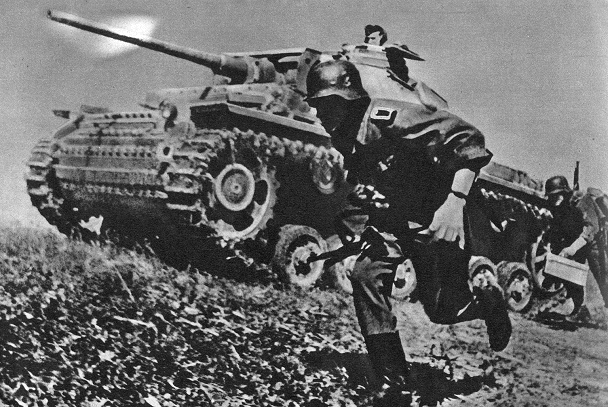
|
| Was Hänschen nicht lernt... |
...lernt Hans nimmermehr! |
|
Achillesferse
exotische Rohstoffe
Nach
dem Ersten Weltkrieg verlor Deutschland alle Kolonien und damit den Zugang
zu exotischen Rohstoffen. Diese konnten nur über "neutrale"
Länder beschafft werden, die sich das fürstlich bezahlen ließen.
Deutschland hatte praktisch keine Ölvorkommen und auch für
Dichtungsmaterialien, Autoreifen und andere kriegswichtige Rohstoffe
fehlte die Basis. Die Chemie war aber bereits auf dem Weg, viele
Materialen synthetisch herzustellen. Deshalb wurde unmittelbar nach der
sogenannten "Machtübernahme" der Nationalsozialisten mit der
Industrie erörtert, welche Schwerpunkte für die Forschung und
Entwicklung zu setzen sind. Die Chemie zeichnet sich generell durch einen
hohen Entwicklungsaufwand aus, der sich allerdings langfristig durch hohe
Gewinne kompensiert. Alles, was man bisher entwickelte oder erfand,
wirkte nach Kriegsperioden noch sehr intensiv und profitabel nach und es ist klar, dass
weltweit viele Erfindungen gar nicht gemacht worden wären, wenn kein
Krieg dahinter gestanden hätte. Die moderne Luft- und Raumfahrt, der Motoren- und
Fahrzeugbau oder der Schiffsbau sind gute Beispiele.
Natürlich
posaunte man gern hinaus, dass Deutschland angeblich von Rohstoffen
unabhängig sei, weil man dazu Alternativen gefunden habe. Gleichzeitig
war der Kriegserfolg die beste Reklame für die neuen Produkte der
Unternehmen. Also verband man Kriegserfolg und Werbung auf billige Art und
Weise. Material und Menschenleben standen auf einer Stufe. Es gab nur
einen Unterschied: Das Material konnte man immer wieder produzieren - die
Menschen waren für immer verloren. So klebt an vielen Produkten noch
heute das Blut von Millionen und die Werbung der gleichen Firmen hat sich
nur in Nuancen geändert.
|
Deutschlands Chemie im Kriege
Von Professor Dr. Krauch
Generalbevollmächtigter des Ministerpräsidenten Generalfeldmarschall Göring
für Sonderfragen der chemischen Erzeugung
Als
Deutschland im vorigen Jahrhundert begann, seine ersten Kriegsschiffe zu bauen -
und es waren tatsächlich nur erste schüchterne Versuche - da riet uns der
englische Politiker Lord Palmerston, "den Boden zu pflügen, mit den Wolken
zu segeln, zu träumen und Luftschlösser zu bauen"; aber wir sollten es
uns im Leben nicht einfallen lassen, "die hohe See oder auch nur
Küstengewässer zu durchfahren!"
Überblickt
man rückschauend die deutsche Geschichte, so gewinnt man den Eindruck, dass
Deutschland in seiner inneren und äußeren Geschichte manche Gelegenheit
versäumt hat, besonders auf technischem und wirtschaftlichem Gebiete. Das wurde
im 19. Jahrhundert anders und die Entwicklung hat gezeigt, dass Deutschland in
der technischen und wirtschaftlichen Daseinsfürsorge - gegen den Wunsch und
Willen Englands - nicht nur Großartiges, sondern schlechthin Einmaliges zu
leisten imstande ist.
|
An
dieser industriellen Versorgung des eigenen Volkes und auch des
Weltmarktes mit Gütern aller Art hat die chemische Industrie einen
beträchtlichen Anteil. Alle Berufe, die in unmittelbarer oder nur
mittelbarer Beziehung zur Chemie stehen, haben eine jahrhundertealte
Tradition in Deutschland, so die Färber, Apotheker, die Metallurgen,
Sprechstofftechniker und natürlich die Chemiker selbst. Aber es schien,
dass der Geist, der in diesen Berufen und ihren Vertretern lebte,
vornehmlich "theoretisch" gerichtet war, in Wirklichkeit war es
jedoch ein Geist, der tief und weit ausholte. Und dieser nationalen
Eigenart verdankt Deutschland die hohe Blüte seiner chemischen Forschung
und Industrie. Man denke, um nur einige Beispiele zu nennen, an die
Synthese der Farbstoffe, die den Engländern von jeher schon viel zu
schaffen machte, an die Herstellung synthetischer Arzneimittel, besonders
solcher der Tropenmedizin, die mithalfen, ganze Landstriche
kolonisationsfähig zu machen, oder denke an die Leistungen Deutschlands
in der Stickstoffchemie, die ganz wesentlich seit jahrzehnten Deutschlands
Äcker fruchtbarer machen und damit eine ganz außerordentliche Bedeutung
für die Sicherung der Ernährung unseres Volkes gewannen.
Die
Chemie ist bei diesen großen Taten nicht stehen geblieben, sie ist zu
einem kraftvollen Motor der Wirtschaft geworden. Sie trotzt mit der Waffe
der Forschung der Natur immer neue Möglichkeiten ab. Seit Jahrzehnten
erleben wir, dass von Jahr zu Jahr weitere, auf die Chemie gegründete
Wirtschaftszweige ins Dasein treten. Die chemische Forschung und
Industrie ist damit zu einem Faktor von größter wirtschaftlicher und
sozialer Bedeutung geworden. Unermüdlich spornt sie die in ihr tätigen
Menschen an, in die Geheimnisse der Natur zu dringen, und immer wieder
stößt sie zu neuen Fragen und Entdeckungen vor. In diesem Drang wirkt
bestes deutsches Wesen: Das durch wirtschaft disziplinierte Erbe des
Volkes der Forscher und Denker. Mit ihren Pioniertaten schafft die Chemie
ständig neue Hilfsmittel zur Verbesserung des Daseins, zum gesünderen
und reicheren Leben. Ob man die Arzneimittel würdigt, die Krankheiten
heilen, oder die Farbstoffe, die nur mit dem Textilgewebe selbst vergehen
können, die Photobilder, die uns unterhalten, oder die Kunstseide oder
Zellwolle, die uns kleiden, den Dünger, der den Acker fruchtbar macht
oder das Benzin, das den Kraftwagen treibt - jede chemische Tat ergibt
eine Bereicherung des Lebens. Und niemals war die deutsche Industrie mit
den Leistungen der Gegenwart zufrieden, stets wandte sie sich mit
wirtschaftlichem Ehrgeiz den Aufgaben der Zukunft zu. Das verlangt die
allerintensivste Pflege der Forschung. Ihr dienen zahlreiche und gut
ausgestattete Laboratorien der Hochschulen und der Industrie und Hunderte
von Versuchsbetrieben. Bei all den Arbeiten, die an diesen Plätzen
ausgeführt werden, ist stets der Mangel an natürlichen Rohstoffen der
Lehrmeister gewesen.
|
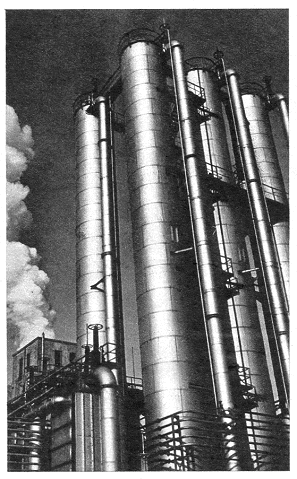 |
In
noch größerem Umfange, noch planvoller aber setzte diese unermüdliche Arbeit
ihren Siegeslauf fort, als der Führer begann, die deutsche Rohstoffversorgung
zu sichern. Die berechtigten Erwartungen hat der Führer und Reichskanzler
bereits ausgesprochen, als er in seiner Rede vor dem Reichstag vom 13. Juli 1934
sagte: "Wir werden dank der Genialität unserer Erfinder und Chemiker und
durch unsere Tatkraft neue Wege finden, uns vom Import jener Stoffe unabhängig
zu machen, die wir selbst zu erzeugen oder zu ersetzen in der Lage sind."
Also bereits seit dieser Zeit und in einer noch vervielfachten Kraftanstrengung
seit Verkündung des zweiten Vierjahresplanes im Jahre 1936 wurde in Deutschland
systematisch daran gearbeitet, Deutschlands Versorgung für alle
Schicksalsfälle zu sichern. Der deutsche Chemiker und der deutsche Arbeiter
haben dieses Ziel erreicht. Die Deutschen haben nicht, wie es sich die
Engländer wünschen, geträumt; Deutschland denkt konstruktiv!
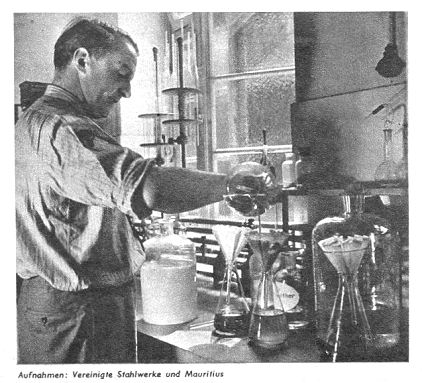 |
Die
erreichten Leistungen haben die Anerkennung der ganzen Welt gefunden.
Unsere synthetischen Treibstoffe, unser
synthetischer Kautschuk werden in
ihrem Wert von niemand, der ernst genommen werden will, angezweifelt. Die
auf allen Gebieten seit der Proklamation des Vierjahresplanes gesteigerte
Produktion, die noch energischer betriebene Erfindertätigkeit, die
stärkere Aktivierung der deutschen energie- und Rohstoffquellen, gaben
darum dem deutschen Volk das Gefühl der Sicherheit, als es in diesen uns
aufgezwungenen Krieg (?!) hinein ging.
Es
sind nicht nur seit Jahren neue Werke entstanden und in Betrieb genommen,
sondern die Bautätigkeit an neuen Forschungs- und
Fabrikationsunternehmungen wird seit Beginn des Krieges unbausgesetzt
weiter betrieben, eine planungsvolle Vorratswirtschaft und der
vorsorgliche Ausbau von Reservekapazitäten sichern die deutsche
Rohstoffversorgung. Daher ist auch die Umstellung ohne Reibung von sich
gegangen; denn Deutschlands Wirtschaft befand sich ja schon vor dem Kriege
in dem zustand planender Vorsorge.
Die
Feinde, die uns mit brutalem Vernichtungswillen diesen Krieg aufzwangen,
haben bereits empfindlich zu spüren bekommen, mit welcher machtvollen
Geschlossenheit und unter welchem ehernen Gesetz das ganze deutsche Volk
denkt und handelt. "Nach diesem Gesetz", so sagte zur
Jahreswende Generalfeldmarschall Göring, "ist auch das gesamte
deutsche Wirtschaftsleben ausgerichtet. Die Heimat ist Waffenschmiede und
Kraftquell für die Front geworden. In Stadt und Land haben sich die
Betriebe und Werkstätten den Erfordernissen der Reichsverteidigung
angepasst. Jede Arbeitskraft wird dort eingesetzt, wo sie am nötigsten
ist. Jede Tonne Rohstoff wird dort verwertet, wo sie der Rüstung der
Kriegsnotwendigen Versorgung des Volkes am besten nützt. In allen
Wirtschaftszweigen werden Höchstleistungen vollbracht." |
Nichts
kennzeichnet mehr die Bedeutung, die der Führer der Mobilisierung aller Lebens-
und Leistungsenergien beilegt, als die Beauftragung von Generalfeldmarschall
Göring mit der Führung der deutschen Kriegswirtschaft. Bei uns fehlt es nicht
an einer klaren Befehlsgewalt, das Verhalten der Verbraucher ist diszipliniert.
Die Forschung setzt ihre Arbeit in verstärktem Maße fort, die Produktion
läuft in allen betrieben auf Hochtouren. Wir stehen also heute in jeder
Beziehung anders da als 1914, vor allem auch wirtschaftlich: den die gesamte
deutsche wirtschaft war auf den Vierjahresplan ausgerichtet, der ihr ja eine
Unabhängigkeit vom Ausland sichert. Ausschlaggebend für diese Unabhängigkeit
ist die deutsche Chemie. Die hervorragenden Eigenschaften des deutschen Soldaten
und diese umfassende Wirtschaftsplanung und ihre Erfüllung sind eine sichere
Gewähr für den Sieg Deutschlands.
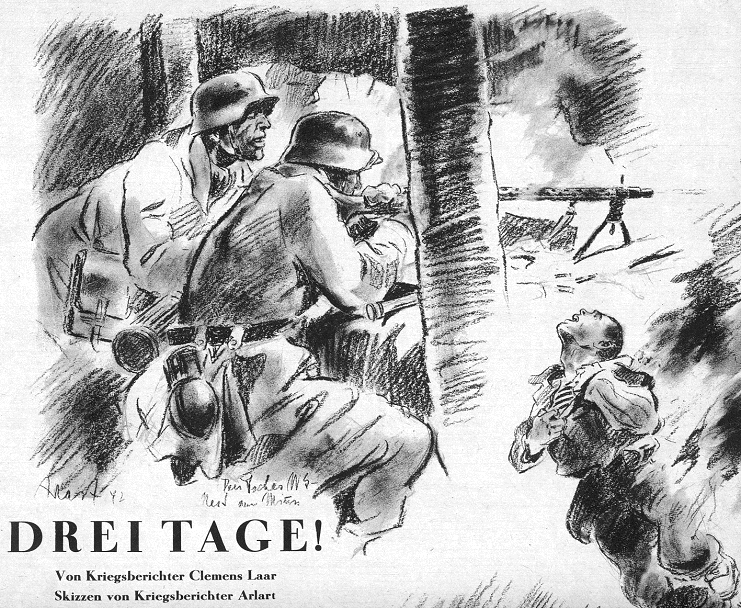 |
An
der Mius-Front
Im
März 1942 befanden sich die beiden Kriegsberichter Clemens
Laar und sein Kollege Alert an der Miusfront ganz in der
Nähe der Krim und wurden in die Kämpfe mit der russischen Armee
verwickelt, die damals eine Offensive starteten. Das eigentliche Ziel war
die Rückeroberung des Donez-Beckens, was auch beinahe gelungen wäre. Sie
stießen auf erfahrene und gut ausgerüstete deutsche Truppen, die
leichtes Spiel mit den mäßig bewaffnet anstürmenden russischen
Bataillonen hatten.
Bemerkenswert
ist im nachfolgenden Bericht, der in Heft 11 am 20. Mai 1942 erschien,
dass er in einer handwerklich poetischen Art abgefasst ist, mit der
bestimmte Leserschichten erreicht werden sollten. Der Krieg sollte etwas
heroisches und gleichzeitig sinnloses sein, wenn er gegen deutsche Truppen
geführt wird. Im Landserjargon kommen die gängigen Bezeichnungen für
gegnerische Waffensysteme ganz gut rüber, die dem Leser an der
Heimatfront eine Hauch Landserleben vermitteln sollten.
Leider
treffen die Schilderungen in hohem Maße die Wahrheit und decken sich mit
vielen Schilderungen damaliger Soldaten. |
|
Waren
es Sekunden oder Tage? Keiner weiß es zu sagen, als alles vorbei ist.
Langsam findet man sich zurecht. Drei Tage, so ordnet man langsam und wie
aus wüstem Traum erwachend den Höllenspuk der Ereignisse.
Drei
Tage!
-
Hat
einer in der Zeit geraucht, gegessen, getrunken?
-
Hat
einer etwas anderes gedacht als schießen, immer nur schießen?
-
War
einer mehr als nur ein Teils seines LMG, seiner Maschinenpistole,
seines Grantwerfers, seines Geschützes?
-
Mehr
als nur kühl wägendes Auge und eisern unberührte Hand?
Infernalische
Gaukelei, entfesselter Wahnwitz, hemmungslos gewordene Urgewalt von Land
und Himmel, Feuer und Stahl von oben und dahinter aus gnadenlosen
Sternenwelten tropfend, mordende Kälte, klammernder Frost und -
unbegreiflich - jäher Umschwung. Regen, Sonne, Wärme und tückisch aus
dem Bauch der Erde brodelnder Urschlamm.
Ansturm
des Aberwitzes, sich zehntausendfach überschlagender Selbstvernich-
tungswahn, wild torkelnde erdbraune Masse, übersehbar aus der Ferne
quillend, Heerscharen von mordenden Robotern und davor der deutsche
Mensch.
Höchste
Bewährung, alle fünfzig, sechzig Meter ein deutscher Infanterist, Weiß
er, was der Kamerad tut? Weiß er genau, ob er nicht noch allein hinter
seiner Waffe liegt und den ihm zugewiesenen Raum verteidigt? |
Drei
Tage!
Es
beginnt am Vortag mit Schwärmen von Ratas. Es prasselt der Hagel
unzähliger Zwei-Kilo-Bomben. Nicht zu zählen dann die wippenden,
schwirrenden und gleitenden Massen der "Obergefreiten", die
roten Anderthalbdecker. In der Nacht stundenlange Arbeit von drei oder
fünf "Kohlenschippern", langsame Maxim-Gorki- Riesenbomber mit
außerordentlicher Ladekraft. Die Bomben prasseln wie Koksstücke von
einer werfenden Schaufel.
Denen
in den Bunkern macht es nichts aus. Man stellt sachlich fest "dicke
Luft" und sieht zum ungezählten Male nach seiner Waffe. Um zwei Uhr
morgens der "Ü.v.D", der Überläufer vom Dienst. Was er
aussagt, beseitigt die letzten Zeifel. Um vier Uhr ist der Russe da. Im
mageren Licht eines wolkenlosen Morgens sehen sie ihn die
Bereitstellungsräume im zerschossenen Dorf, vierhundert Meter vor der HKL,
beziehen. Auf den B-Stellen machen Bleistiftstriche durch blaue Kreise im
gegnerischen Abschnitt tödliche Kreuze. Über den Horizont, rechts und
links, so weit das Auge blickt, quillt es aus dem Nichts. Russlands
verfluchte Erde, das weiß zerfetzte Leichentuch des Schnees gebären
Krieger. Nein, Kampfmaschinen, entfesselte Dressurakte in Menschengestalt,
Welle auf Welle ein unversiegbarer Strom tückischer Ameisen, das
Verderben aus dem Osten, Satans ewiges Heer.
Die
hinter den deutschen Waffen haben ein dünnes Lächeln um den Mund. Die
Sicht ist gut, mehr verlangen sie nicht. |
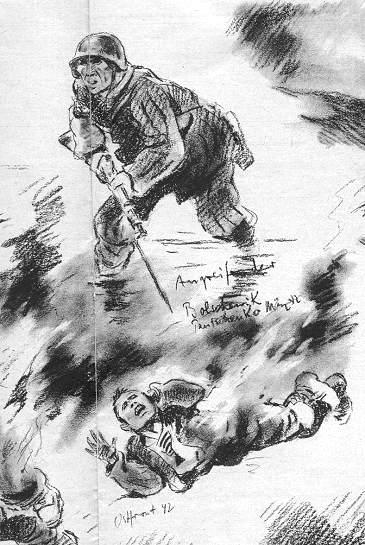 |
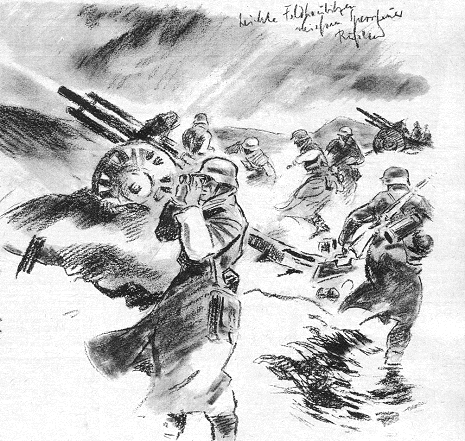 |
|
Vier
Uhr zwanzig. der Kommandeur gibt das Zeichen Enzian. In gewaltiger Tiefe
und Breite gibt es jetzt keinen Quadratmeter russischer Erde, über dem
meterhoch die Luft nicht zerschnitten ist von kreischendem,
zerschmetterndem, vernichtendem Stahl und Blei. Was tut es der Masse. Was
macht es, dass Tausende schon in der Bereitstellung auf festgelegten
Zielpunkten zerfetzt werden. Sie feiern ihre Orgien der Selbstvernichtung.
Es
wird Mittag und es wird Abend. Da und dort schreit einer von den Schwaben
auf, "sie drucke durch, sie drucke durch!" Was machts, der
Kampfauftrag geht nach vorn und wo die braune Urgewalt der Wesenlosigkeit
durchgestoßen ist, da fangen sie Artilleristen aus ihrer Stellung
sechshundert Meter hinter der HKL, da greifen Pioniere und
Brückenbautrain mit geballten Ladungen an.
Die
Dämmerung enthüllt, was im flirrenden, stechenden Licht des Mittags
nicht ganz klar zu sehen, vom hetzenden Bewusstsein nicht ganz aufzunehmen
war. Die Vernichtungsorgie da drüben entzündet ihre Feuer und hetzende
Gestalten torkeln kriechend und winbden sich als lebende Fackeln dem
Jenseits zu. Sie trogen Molotow-Cocktails. In der Handgranantentasche sind
sie zerbrochen oder zerschossen. Überschlägt sich bei denen da drüben
nicht das Grauen?
Nacht
und immer erneuter Angriff. Pausenlos. Gegen Morgen Abflauen. Flüchtige
Zählungen der Totenberge unmittelbar vor und auch in den eigenen
Stellungen. Mehr als siebentausend auf der Abschnittsbreite zweier
deutscher Bataillone. |
Schneesturm,
Regen, quellender Urschlamm. Der Russe kommt immer wieder erneut. Der
blutige Spieler, der drüben die Karten austeilt, will nicht aufstehen,
bevor nicht der letzte Einsatz vertan ist. Es hämmern von drüben schwere
Waffen, Artillerie gewaltiger Kaliber. Es kommen in den Morgenstunden die
Legionen der "Obergefreiten", aber was sie werfen, das geht in
diesigem Licht in die eigenen Reihen. Hier züchtigt Gott.
Sekunden,
Stunden, Tage? Es werden drei Tage und dann stoßen von drüben nur noch
sickernde Trupps in den sicheren Tod. Schneesturm kommt auf und verhüllt
gnädig, was das Auge jetzt manchmal nicht mehr begreifen will aber doch
begreifen muss. Der Schnee vergeht, das Hochwasser kommt, der Schlamm
umspült ein unübersehbares Gefilde der Toten und manchmal sieht es so
aus, als erhöbe sich im weiten Umkreis des Lichtes ein schlafendes
gigantisches Heer.
Aber
es wird sich nie wieder erheben.
Wir
zählten schließlich, dass es an die elftausend Mann waren. Elftausend
Mann, die an drei Tagen zwanzig oder dreißig Meter vor oder hinter uns
zermalmt wurden. Drei Tage von mehr als hundertfünfzig Tagen dieses
Winters, den kaum war es je anders. Auf zwölf Kilometer von
dreitausend! Wir wollen nicht zählen, was zwischen den Linien liegt. Das
Hochwasser dieser Tage und der reißende Mius werden gnädig sein und sie
in das große Nichts des Meeres führen. |
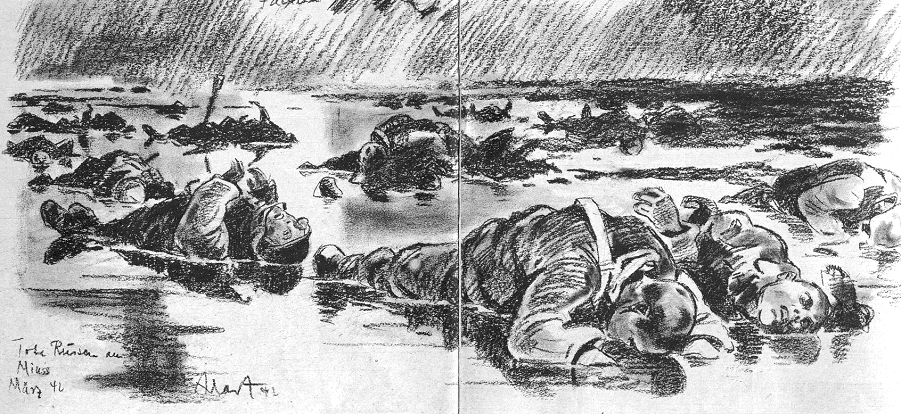
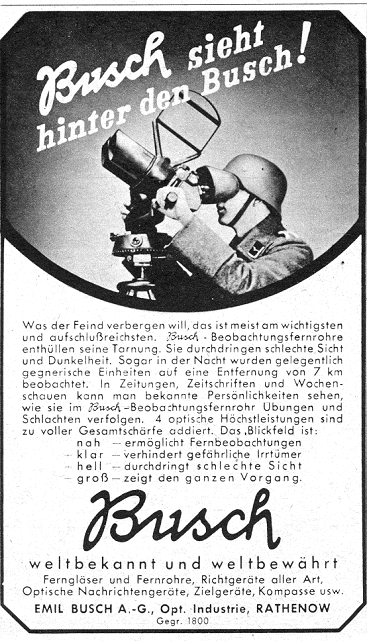
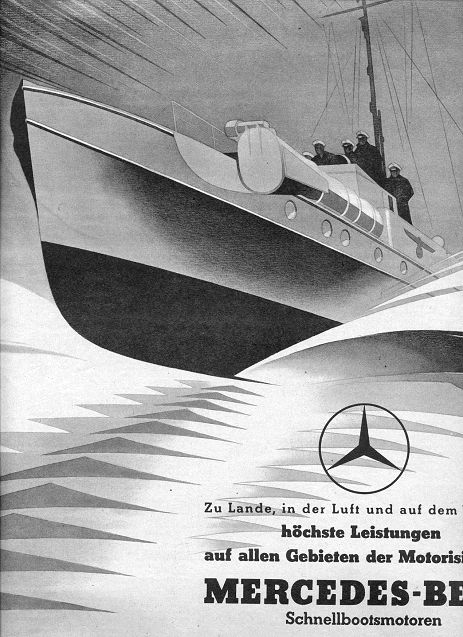 |
|
Nicht
alle Generalunternehmer des "Dritten Reiches" warben - aus gutem
Grund!
Ein
sehr gutes Beispiel ist die Accumulatorenfabrik AFA, die an beiden
Weltkriegen enorm profitierte und nach dem Krieg völlig unbehelligt in
VARTA umbenannt wurde. Mit Unterstützung der Alliierten konnten sie
danach am Aufschwung profitieren und ihre Besitzer, die Familie Quandt, zu
gewaltigem Reichtum führen. Die Maxime des Firmeninhabers Günther Quandt
war, sich möglichst unauffällig zu geben, wozu auch kriegsrelevante
Werbung gehörte. Man dachte bereits an die Möglichkeit, dass der Krieg
verloren gehen würde und die unselige Verstrickung in die Vernichtung von
Zwangsarbeitern durch Arbeit den zukünftigen Geschäften schaden könnte.
So findet sich auch in den Heften Die Wehrmacht keine einzige
Werbung, obwohl in jedem Kriegsgerät nur eine einzige Batteriemarke
vertreten war: AFA.
Wie
eine Dokumentation des NDR belegt, gab es zwischen Quandt, der SS und der
Gestapo Kooperationen, um sich das Eigentum von Batteriefirmen der
besetzten Gebiete anzueignen. Es reichte nicht, dass man in den
beschlagnahmten Produktionsstätten als AFA produzierte, die Eigentümer
wurden auch mit Aufenthalten in Konzentrationslagern genötigt, ihr
Eigentum an Quandt zu verkaufen.
Wie
groß die Rolle der AFA und der Quandts in beiden Weltkriegen war, kann
dem Link http://www.schoene-aktien.de/accumulatoren_alte_aktien.html
entnommen werden. Es ist eine Schande, dass die Quandts nicht für ihre
Verberechen herangezogen wurden. Sie wurden sogar komplett entnazifiziert,
also von jeder Schuld befreit. Ein amerikanischer Historiker meinte in der
NDR-Dokumentation, dass die Missstände bei der Entnazifizierung so groß
gewesen seien, dass sogar Adolf Hitler mit den richtigen
Zeugenaussagen als Mitläufer eingestuft worden wäre. Heute gelten die
Quants als ehrenwerte Gäste bei großen Ereignissen und wollen auf ihre
Vergangenheit nicht angesprochen werden. Sie leben von ihrem gigantischen
Vermögen, während die überlebenden geschundenen Zwangsarbeiter bis
heute keinen Pfennig Entschädigung gesehen haben.
|
|
Trümmer
- Prüfung - Sezierung - Auswertung
UNTER
DEM SEZIERMESSER DEUTSCHER LUFTWAFFEN-INGENIEURE
|
|
In
den mit der Beuteauswertung betrauten Stellen des Generalluftzeugmeisters
werden feindliche Beuteflugzeuge, die deutsche Jäger oder Flak zum
Absturz oder zur Landung gezwungen haben, auf Dinge untersucht, die die
deutsche Luftwaffe für die erfolgreiche Bekämpfung des feindlichen
Geräts interessieren. So wird es möglich, den technischen Stand der
gegnerischen Flugzeuge samt ihrer Ausrüstung genau zu kontrollieren und
zu überwachen. Neu auftretende Panzerschutzplatten werden sofort
ausgebaut und Beschussversuchen unterworfen. MG und Bordkanonen der
feindlichen Flugzeuge werden mit der dazugehörigen Munition durch
Schußversuche auf ihre Durchschlagskraft geprüft, damit nach diesen
Ergebnissen unsere eigene Flugzeuge mit genügend starken Panzerplatten
geschützt werden können. Bei den eingebauten beweglichen MG werden die
Schwenkbereiche und toten Winkel festgestellt. So können unseren
abschießenden Jägern wichtige Angaben über die günstigsten
Angriffspositionen gegeben werden. Einzelne Bauteile werden auf geeigneten
Prüf- und Meßständen nach besonderen Richtlinien für den Flugzeugbau
geprüft. |
Materialproben
von der Zelle des Flugzeuges und von den Motoren werden ausgeschnitten und
Festigkeitsproben unterworfen. In vielen Fällen ist es möglich, durch
Notlandung leicht beschädigte Flugzeuge wieder aufzurüsten und einer
Flugerprobung zu unterwerfen. Auf diese Weise gewinnt man einen genauen
Überblick über Flugeigenschaften, die für den taktischen Einsatz von
Wichtigkeit sind: Geschwindigkeit, Flughöhe, Wendigkeit bei Jägern,
Reichweite der Bombenflugzeuge bei bestimmten Bombenlasten usw.
All
diese Versuche und Erprobungen zusammengefaßt geben der deutschen
Luftfahrtindustrie wertvolle Hinweise, wie der Vorsprung in der Rüstung
zur Luft immer mehr vergrößert werden kann. Besonders aber gewinnt die
Luftwaffe auf diese Weise wichtige Unterlagen über Einsatz- und
Angriffsmöglichkeiten sowie über die erfolgreiche Abwehr der feindlichen
Flugzeuge. |
|

Abgeschossene
"Spitfires" und "Hurricanes" türmen sich zu leinen
Bergen. Zahlreiche Güterzüge bringen ihre Trümmer von den Sammelstellen
im besetzten Gebiet in die mit der Beuteauswertung betrauten Stellen nach
Deutschland. |
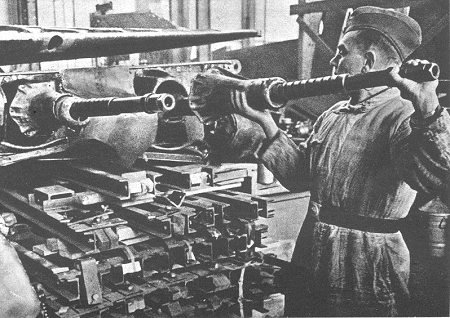
Eine
2-ccm-Bordkanone ist aus einer "Hurricane" ausgebaut worden.
Durch Schießversuche mit erbeuteter Munition wird die Durchschlagskraft
ermittelt. |
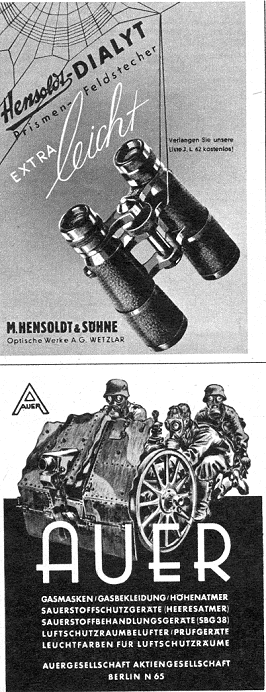 |
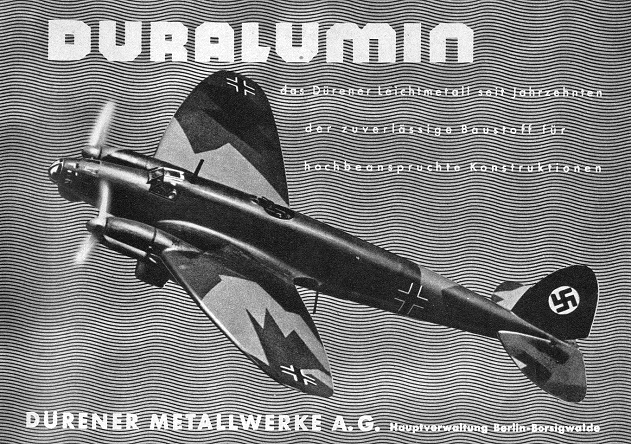
|
|

|
Rüstungswettlauf
unter Kontrolle
Die
ständige Verbesserung der Flugzeuge und der Waffen war natürlich
kriegswichtig. Für die Firmen, die maßgeblich an der Entwicklung
arbeiteten sicherte diese vom Staat finanzierte Entwicklungsarbeit beste
wirtschaftliche Voraussetzung auch nach dem Krieg.
Zur
Beschleunigung der Entwicklung war es wichtig, dass man genauestens über
den Stand der gegnerischen Entwicklung informiert war. Genau diesem Zweck
dienten die Sichtungen des Kriegsschrotts. Die Aluminiumwerke erhielten so
genaueste Kenntnis von neuen Technologien für den Flugzeugbau. Für die
Motorenhersteller waren die Erkenntnisse ebenso von unschätzbarem
Wert.
Natürlich
bedienten sich die Alliierten der selben Methoden, auch wenn es ungleich
schwerer war, vor 1943 an Beutestücke heran zu kommen. |
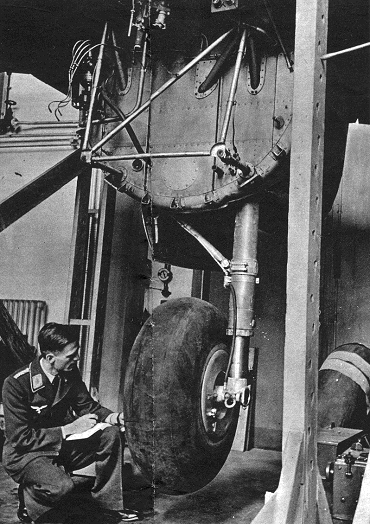 |

Links:
Das Fahrwerk eines amerikanischen Bombers, der über dem besetzten
französischen Gebiet abgeschossen wurde, auf dem Prüfstand. Der deutsche
Luftwaffen- ingenieur prüft zunächst die Bereifung, Achse und Federn,
bevor weitere Versuche unter dem Fallhammer, der dem Füllgewicht des
Flugzeuges bei der Landung entspricht, gemacht werden.
Oben:
Der Führersitz-Rückenpanzer eines abgeschossenen Jagdflugzeuges wird mit
einer Lehre auf seine Stärke gemessen. |
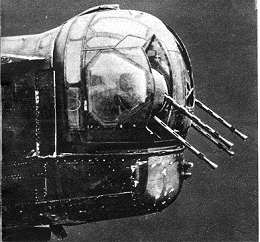
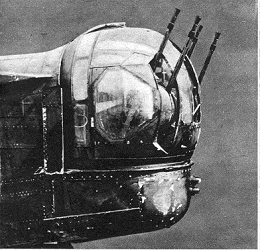
|
Rechts
oben und unten: Bei diesen eingebauten doppelten Zwillings-MG am Heckturm eines
viermotorigen englischen Kampfflugzeuges vom Muster "Halifax" werden
sie Schwenkbereiche der Maschinengewehre geprüft.
Oben
links: Aus einem "Vickers-Wellington-Bomber", dessen Gerüst noch gut
erhalten ist, werden Sauerstoffgerät und die noch unversehrten Kabelanlagen
geborgen und in der Auswertungsstelle der deutschen Luftwaffe einer gründlichen
Prüfung unterzogen.
Oben
rechts: Ein englischer Flugzeugmotor vom Typ "Bristol-Hercules XI"
wird zur Untersuchung der Einzelteile auseinandergenommen. Dieser Motor hat
keine Ventile, sondern Schiebersteuerung.
 |

|
Oberfeldwebel
Moldenhauer (rechts)
und
seine Mannschaft auf einem
seiner
vorangegangenen Flüge |
|
Am
10. Februar 1940 macht ein Erlebnis deutscher Flieger die Runde durch die
ganze Welt.
Mit
schwerverwundetem Flugzeugführer, einem des Fliegens unkundigen Mann am
Steuer, mit 80 Treffern in der Maschine war es der deutschen
Flugzeugbesatzung gelungen, ihre Maschine von der äußersten Grenze der
Nordsee in ihren Heimathafen zurück zu bringen . Eine fliegerische
Leistung von solchem Ausmaß, dass jedes Mitglied der Besatzung von
Feldmarschall Göring mit dem EK 1 ausgezeichnet wurde. Eine
Bewährungsprobe für deutsches Material, aber auch, wie man sie sich
nicht besser denken kann.
Schwer
rollen die Räder der Flugzeuge durch den tiefen Schnee des Flugplatzes.
Erst am Rand des Platzes heben sich die Maschinen vom Boden. Es ist neun
Uhr dreißig. Die Konturen der Landschaft verschwinden sehr schnell unter
uns. Schon sind wir über der Eisdecke der Deutschen Bucht, aber auch das
Eis wird bald bröckelig, löst sich in Eisfelder auf - jetzt sind wir
über der freien See und harren der Dinge, die uns der heutige Tag bringen
mag.
Deutsche
Minensuchboote - ein gegenseitiger Gruß, dann ist die See leer. Vor uns
liegt eine starke Dunstschicht, in die wir hinein müssen. Wir sind jetzt
etwa fünfzig bis hundert Meter hoch. Verdammt noch mal, im Dunst
entwickelt sich Schneetreiben - das hat uns gerade noch gefehlt. Wir
können knapp hundert Meter weit sehen. Wir schließen dicht auf die
Kommandeursmaschine auf, um sie nicht zu verlieren. Erst nach einer Stunde
sind wir aus dem Dreck heraus. Nun müssen wir aber schon nahe der
englischen Küste sein.
"Ich
sitze", erzählt Oberfeldwebel Lohel, "schon seit geraumer Zeit
im Heckstand, um die Maschine vor unange- nehmen Überraschungen zu
sichern. Da höre ich plötzlich durch unser Haustelefon, wie der
Beobachter den Flugzeugführer auf eine Rauchwolke am Horizont aufmerksam
macht. Wir nehmen sofort Kurs auf dieses Ziel und machen auch schon nach
kurzer Zeit einen großen Frachter aus. Schon aber sichten wir weitere
Schiffe, immer mehr Schiffe... Einen ganzen feindlichen Geleitzug. Jetzt
kann die Sache dramatisch werden.
Auf
Steuerbordseite sehen wir ein kleines Vorpostenboot, das offensichtlich
mit der Dampfpfeife Alarmsignale ausstößt. Klar, dass wir jetzt bald
englische Flieger auf dem Hals haben müssen. Wen sollen wir jetzt zuerst
angreifen? Etwa die zwanzig bis dreißig Handelsschiffe mit ihren
Zerstörern und Kreuzern? Wäre ziemlich glatter Selbstmord. Also
entschießen wir uns, unserem Heimathorst von diesem Geleitzug Kenntnis zu
geben. Wir bleiben immer in der Nähe des Feindes, um unsere Kameraden
durch Funk zu verständigen. Ich habe gerade den Funkspruch
verschlüsselt, als auch schon zwei feindliche Jäger über uns sind. Aus
ist es mit dem Funken. Und jetzt wird geschossen.
Ich
setze dem Gegner eine ganze Trommel in die Kanzel, wo sich sofort
Rauchentwicklung zeigt. Auch er scheißt wild. Während des ersten
Feuerwechsels zischen die Geschosse um mich. Links und rechts von mir
klatscht es in die Verschalungen. Plötzlich verspüre ich einen
brennenden Schlag über dem Auge und schon läuft mir das Blut übers
Gesicht. Vier Zerstörerflugzeuge sind es jetzt, die uns angreifen. Wenn
das keine Überlegenheit ist...! Aber niemand von uns verliert den Mut.
Durchladen, schießen, wieder durchladen, schießen erfolgt
exerziermäßig.
|
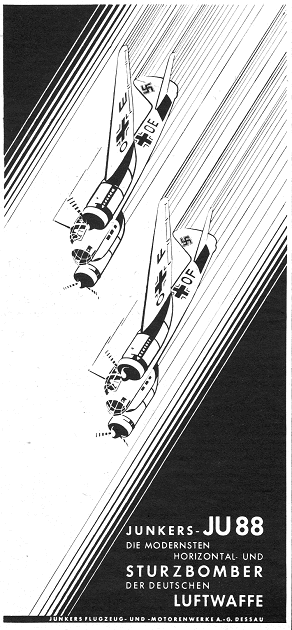
|
Als
unser Mordmechaniker merkt, dass die Angriffe meist von einer Seite kommen,
reißt er sein MG aus der Bodenlafette heraus, stößt es durch das
Seitenfenster und jagt so eine Geschossgarbe nach der anderen in die Kanzel des
Feindes. Dabei macht unsere Maschine geradezu hervorragende Abwehrbewegungen.
Einmal steht sie Kopf, dann zieht sie so steil in die Höhe, dass man glauben
könnte, sie rutsche sofort wieder ab, dann sitzt sie in den Wolken um im
nächsten Augenblick im Sturzflug nach unten zu rasen... ."
Die
glänzenden Abwehrbewegungen macht das Flugzeug nicht ganz freiwillig, denn
inzwischen hat sich auf dem Führerstand des Flugzeuges etwas ereignet, von dem
Oberfeldwebel Lohel nichts ahnte. Darüber berichtet im folgenden der Beobachter
Oberleutnant Münter: "Eben ruft uns der Bordfunker durch das Haustelefon
zu: "Zerstörer von hinten!" Ich springe auf, stütze mich mit der
linken Hand auf den Rücken des Flugzeugführers, um nach links durchs Fenster
zu sehen und entdecke tatsächlich in nächster Nähe vier Zerstörerflugzeuge.
Noch in dieser Stellung brachen die ersten Treffer in unsere Kanzel und zwar
zwischen meine Finger der linken Hand in den Rücken meines Flugzeugführers.
Die sonst so straffen und angespannten Gesichtszüge meines Oberfeldwebels
Moldenhauer werden plötzlich blaß und langsam sinkt Moldenhauers Körper nach
vorn aufs Steuer.
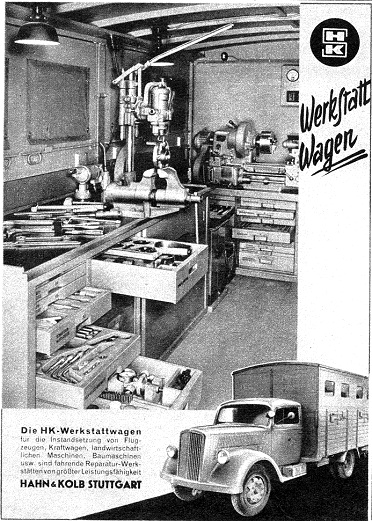 |
Jetzt
heißt es, die Maschine zu halten und unterstützt von dem vorn in der
Kanzel liegenden Hilfsbeobachter ziehen wir die Maschine mit aller Kraft
nach oben. Ich versuche nun, mit der linken Hand den besinnungslosen
Flugzeugführer von seinem Sitz zu ziehen, was mir schließlich auch mit
großer Anstrengung gelingt. Langsam sinkt Oberfeldwebel Moldenhauer
zwischen dem linken und dem rechten Sitz zusammen und bleibt hier
zunächst liegen, bis ihn später der Hilfsbeobachter auf den rechten Sitz
legt.
Moldenhauer
war der einzige fliegerisch ausgebildete Mann an Bord, Ich selber hatte
genau wie die anderen noch niemals ein Steuer angefasst, aber Not bricht
Eisen - ich schwinge mich auf den linken Sitz und versuche, die Maschine
zu steuern. Es war wichtig für uns, die Wolkengrenze zu erreichen, um uns
dem überlegenen Gegner zu entziehen. Kaum aber hatte ich die Maschine ein
paar Minuten in den Wolken drin, als auch schon etwas Entsetzliches
geschieht. Mir war offensichtlich nicht mehr ganz klar, was oben und unten
war und ich hatte die Maschine daher anscheinend überzogen, und so
rutschte sie über die linke Fläche mit Vollgas im Sturzflug nach unten.
Wir sehen das Wasser mit rasender Geschwindigkeit auf uns zukommen. Ich
glaube, jeder von uns sah sein Ende nahe vor sich. Mit aller Kraft ziehe
ich den Knüppel an den Bauch und - der liebe Gott ist auf unserer Seite -
dicht über der Wasseroberfläche fängt sich die Maschine und es geht
wieder nach oben. Zweimal wiederholt sich das Manöver. Jedesmal, wenn wir
aus den Wolken stürzen, werden wir von den Engländern angegriffen und
heftig beschossen. Was meine Besatzung auf diesem Fluge an Mut und Können
leistete, lässt sich in Worten nicht wiedergeben.
Schließlich
ist uns das Glück einigermaßen hold und wir erreichen wirklich die
Wolkengrenze. Vorsichtig gehe ich in die Wolke, um Kurs nach Deutschland
zu nehmen. Aber was ist das? Die Maschine ist beim besten Willen nicht
nach rechts herum zu kriegen. Ich kann nicht feststellen, ob etwas
zerschossen ist oder ob die Sache an meiner mangelnden fliegerischen
Fähigkeit liegt. Auch meine Bordwart kann ich nicht zur Hilfe rufen, denn
jeden Augenblick müssen wir mit einem neuen Angriff rechnen. Wir waren
nun in einer riesigen Linkskurve geflogen und Oberfeldwebel Lohel stellte
plötzlich fest, dass wir Kurs auf den Atlantik haben. Sie Sonne - es ist
13:30 Uhr - steht hinter der Maschine... . Wir müssen ihr aber gerade
entgegen. Endlich können wir jetzt richtigen Kurs Heimat nehmen."
"Wir
kümmern uns inzwischen um den verwundeten Kameraden", berichtet
Oberfeldwebel Lohel über den Rest des heroischen Fluges. "Ich
schneide ihm mit einem Taschenmesser die Kleidungsstücke vom Kopf bis zu
den Hüften auf und verbinde seine heftig blutenden Einschüsse
notdürftig. Dann werden alle verfügbaren Kleidungsstücke aus der
Maschine herangeholt, mit denen wir dem Schwerverwundeten ein
provisorisches Lager bereiten. |
Der
Bordmechaniker überprüft indessen den Benzinverbrauch und pumpt Betriebsstoff
in die Tanks um. Da fängt ein Motor an, unregelmäßig zu laufen. Die Touren
lassen nach und wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen, nun doch noch
auf hoher See notlanden zu müssen.
Das
Schlauchboot wird griffbereit gemacht. Notproviant, Leuchtmunition und die Ruder
zurechtgelegt. Wie lange wird der Motor noch laufen? Der Bordmechaniker ist
emsig bemüht, ihn in Gang zu halten. Plötzlich gibt der verwundete
Flugzeugführer durch Zeichen zu verstehen, dass er etwas schreiben will.
Schnell wird ihm das nötige gereicht. Gespannt folgen wir jedem Zug seiner
unsicheren Hand. Da stehen jetzt die Worte "Latten verstellen"
geschrieben. Trotz seiner schweren Verwundung hat er den Fehler sofort erkannt.
Der Schaden ist bald behoben als der Motor wieder ruhig läuft.
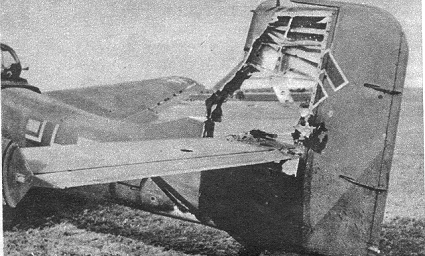 |
Zur
Ruhe sollten wir aber noch nicht kommen. Wir nähern uns jetzt dem Teil
der Strecke, der im Blindflug zurückgelegt werden muß, da
Vereisungsgefahr besteht und uns außerdem das Schneetreiben nur eine
Sicht von etwa 100 Meter lässt. Dickes Eis setzt sich bereits an
Flächen, Maschinengewehr und Antennenmast fest. Unser neuer
Flugzeugführer bringt die Maschine im Sturzflug bis dicht über den
Meeresspiegel. Es gelingt ihm auch tatsächlich, die Maschine ein paar
Meter über dem Wasser abzufangen. Mit dem Heimathafen haben wir keine
Verbindung mehr. Seit vielen Stunden sind wir schon unterwegs. Sicher wird
man uns schon vermissen.
Endlich
kommen wir aus dem Schneetreiben heraus. Die Wasserfläche unter uns wird
langsam ruhiger, ein Zeichen, dass wir uns dem zugefrorenen Teil der
Deutschen Bucht nähern. Zusammengedrängt sitzen wir alle vorn in der
Kanzel und warten sehnsüchtig, dass Festland in Sicht kommt. Unsere
Gedanken sind bei unserem schwer verwundeten Kameraden. Wird er wohl bis
zur Heimat durchhalten? Wie werden wir ohne ihn überhaupt die Landung
durchführen? Wir kommen überein, dass wir sie mit eingezogenem
Fahrgestell im hohen Schnee durchführen. Es ist ein gewonnenes Spiel,
wenn wir nur erst einmal Land unter uns haben. Die Notlandung selbst
bereitet uns keinen Kummer. |
Doch
es kam anders als wir es uns dachten! Nach einer halben Stunde Flug haben wir
tatsächlich die Eisdecke unter uns, sehen auch gleich ein deutsches
Vorpostenboot, das uns begrüßt und wir hoffen mit Zuversicht, zum
Abflugflughafen zu kommen. Kurz danach überfliegen wir bereits unseren heimatlichen
Fliegerhorst und geben durch Abschießen einer roten Leuchtkugel zu verstehen,
dass wir einen Verwundeten an Bord haben. In diesem Augenblick kommt unser
schwerverwundeter Flugzeugführer wieder zu sich. Er gibt zu verstehen, dass er
die Landung selbst vornehmen will. Wir steigen mit der Maschine auf 1000 Meter,
heben unseren alten Kämpen in seinen Sitz und vom Bordmechaniker unterstützt,
legt er eine derart saubere Landung hin, dass wir aus dem Staunen nicht
herauskommen. Dann ist aber auch der Rest seiner Kraft dahin. Er sinkt zum
zweiten Mal hinter seinem Steuer zusammen... ."
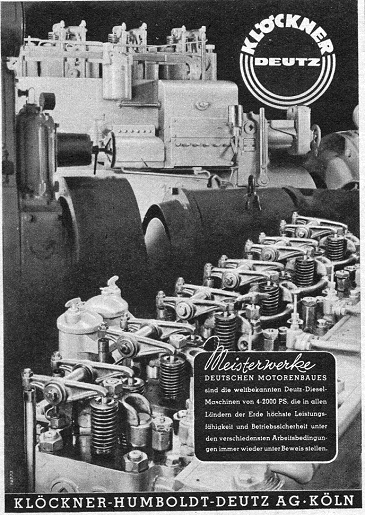 |
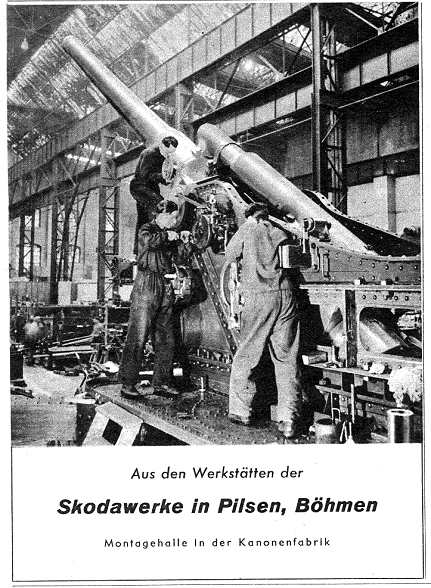
|
|
Die
Radiosender des OKW (Oberkommandos der Wehrmacht)
Am
1. September 1939 nahmen die Radiosender des OKW ihren Betrieb auf und
betrieben bis zum 9. Mai 1945 Information und Propaganda, die auf der
ganzen Welt empfangen werden konnte. Dahinter stand eine gigantische
Propagandagruppe, die bis tief in die Heeresverbände, die Luftwaffe und
die Marine reichten, um die Wehrmachtsangehörige und die
Zivilbevölkerung mit Informationen zu füttern, die geeignet waren, die
Stimmungen während der Kriegsjahre zu beeinflussen.
So,
wie die Hefte "Die Wehrmacht" erstellt wurden, so stellte man
auch die Radio-Sendungen zusammen. Die Kriegsberichterstatter und
Journalisten unterlagen der Zensur. In den Sendungen des OKW war praktisch
kein Spielraum, denn die Texte wurden überwiegend übermittelt.
Angehörige
der Propagandatruppe waren:
-
Lothar
Günther Buchheim: Schriftsteller ("Das Boot"),
Verleger von Kunstbüchern und Kunstsammler.
-
Kurt
W. Marek / C.W. Ceram: Sachbuchautor ("Götter, Gräber
und Gelehrte", "Enge Schlucht und Schwarzer Berg").
-
P.C.
Ettighofer: Schriftsteller, vor allem bekannt geworden mit
Werken über den 1. Weltkrieg ("Gespenster am Toten Mann").
-
Joachim
Fernau: Schriftsteller und Sachbuchautor ("Sprechen wir
über Preußen", "Disteln für Hagen").
-
Rudolf
Hagelstange: Schriftsteller und Übersetzer ("Spielball
der Götter", "Altherrensommer").
-
Werner
Höfer: Leitende Tätigkeit beim Fernsehen, Langjährig
Moderator des "Internationalen Frühschoppen".
-
Karl
Holzamer: Erster Indendant des ZDF.
-
Werner
Keller: Sachbuchautor ("Und die Bibel hat doch
recht". "Denn sie entzündeten das Licht - Geschichte der
Etrusker").
-
Henri
Nannen: Herausgeber des STERN.
-
Jürgen
Roland: Regisseur, vor allem für Krimiserien
("Stahlnetz", "Großstadtrevier").
-
Ernst
Rowohlt: Verleger (RoRoRo-Taschenbücher).
-
Manfred
Schmidt: Zeichner und Karikaturist ("Nick Knatterton").
-
JürgenThorwald:
Sachbuchautor ("Die Illusion - Rotarmisten in Hitlers
Heeren". "Das Ende an der Elbe").
-
Peter
von Zahn: Fernsehjournalist ("Reporter der Windrose"
- Vorläufer der heutigen Magazinsendungen wie Weltspiegel).
Quelle:
Archiv der Wehrmacht
Am
07.05.1945 kamen die letzten Wehrmachtsberichte über Äther
Reichssender
Flensburg: OKW-Bericht
Am
07.05.1945 wurde die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht
in Reims unterzeichnet, am 08./09.05.1945 in Berlin-Karlshorst wiederholt.
Die Nebenstelle Flensburg des Reichssenders Hamburg, nun zum
"Reichssender Flensburg" geworden und zum einzig verbliebenen
Rundfunksender der "Regierung Dönitz", übertrug am 09.05.1945
den letzten OKW-Bericht des Zweiten Weltkrieges.
Reichssender
Flensburg: Letzter Wehrmachtsbericht
"Aus
dem Hauptquartier des Großadmirals am 09.05.1945. Das OKW gibt bekannt
..." / Ostpreußen / Kapitulation von Breslau / Aufstand in Böhmen
und Mähren / "Seit Mitternacht wurden die Waffen an allen Fronten
niedergelegt" / "Die deutschen Streitkräfte sind schließlich
ehrenhaft der erdrückenden Überlegenheit erlegen".
3'00
Mittwoch, 9. Mai 1945
Am
7. Mai 1945 wurde die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht
in Reims unterzeichnet, am 8./9. Mai in Berlin-Karlshorst wiederholt. Die
Nebenstelle Flensburg des Reichssenders Hamburg, nun zum
"Reichssender Flensburg" geworden und zum einzig verbliebenen
Rundfunksender der "Regierung Dönitz", übertrug am 9. Mai 1945
den letzten OKW-Bericht des Zweiten Weltkrieges.
Seit
dem 1. September 1939 hatten die deutschen Rundfunkanstalten täglich
einen militärischen Nachrichtenüberblick ausgestrahlt (und im Laufe des
Tages mehrfach wiederholt), der mit den Worten begann "Das
Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt...". Der Text des
OKW-Berichts wurde im wesentlichen vom Wehrmachtsführungsstab formuliert
und durfte von journalistischer Seite nicht redigiert werden.
Weitere
Informationen sind unter dem nachfolgenden Link erhältlich.
http://www1.ndr.de/unternehmen/technik/rundfunktechnik/jahreradio4.html
|
|

An
die Sprechgenauigkeit des Rundfunkansagers (Im Bild Elmar Banz
vom Reichssender Berlin) stellen die Bekanntgaben des Oberkommandos der
Wehrmacht, die in langen Papierbändern vom Fernschreiber kommen, mit den
vielen fremden Ortsnamen besonders hohe Anforderungen. |
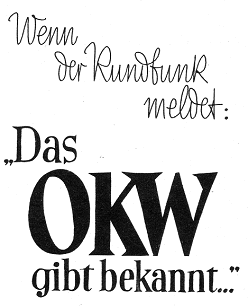
Jeder
von uns hat die Spannung der Hörer miterlebt, wenn der Rundfunk die
Meldungen von den Erfolgen unserer Soldaten mit den Worten einleitet:
"Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt..."
Aber
nicht jeder wird wissen, daß beim Rundfunk ständig erhöhte
Alarmbereitschaft herrscht und daß diese Bereitschaft erhebliche
Anforderungen an das Personal des Rundfunks stellt.
|

Die
elegante Haupttreppe des Hauses an der Masurenallee in Berlin kann sich
nicht genug wundern über die neue Art der Beleuchtung, die der Hauswart,
der zugleich Hausfeuerwehrmann ist, seit einiger Zeit jeden Abend
anbringt. |
|
|

Es
liegt in der Natur der Zeitereignisse, daß die Rundfunkleute heute mehr
improvisieren müssen als in Zeiten geregelten Programmbetriebs. Da sind
die Schätze des Schallplattenarchivs eine große Hilfe |

Im
Herzen des Riesenhauses. dem Raum des Leiters vom Dienst, rasselt
mindestens stets eins der vielen Telefone, um den Diensthabenden nicht
einmal zum Genuß des Mittagessens kommen zu lassen.
|
|
|

Ein
Blick in den Luftschutzkeller des Gebäudes zeigt, daß dort bereits
Tische und Schreibmaschinen, durch Zettel für verschiedene Abteilungen
reserviert, bereitstehen, um im Fall eines Luftalarms ein behelfsmäßiges
Büro zu bilden. |
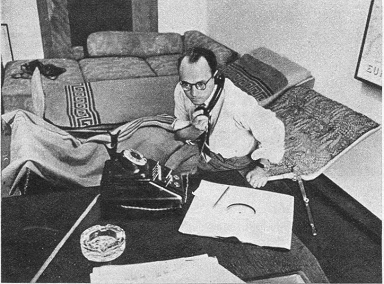
Auch
beim Rundfunk gibt es erhöhte Alarmbereitschaft: Chefredaktuer Dr. Laven
hat einen Teil seines Büros als Schlafzimmer eingerichtet, um jederzeit
erreichbar zu sein |
|
|
Die
Flak-Türme
stehen heute noch
Nachdem
unsere Luftwaffe englische Städte und Wohngebiete bombardiert hatte,
hielt die Alliierten nichts mehr davon ab, auch die deutschen Städte in
Schutt und Asche zu legen. In den Großstädten baute man sogenannte
Flak-Türme, die über vier Plattformen verfügten, die in über 30 Meter
Höhe rund um die Uhr einsatzbereit waren.
Die
Türme verfügten über eine eigene Feuerleitzentrale und zentrale
gepanzerte Munitionsaufzüge. Bestückt waren sie mit 8,8 cm-Flak und
Vierlingsflaks. Die Betontürme waren so massiv gebaut, dass sie nach dem
Krieg kaum abgerissen werden konnten.
Für
viele Frontsoldaten waren die Flaktürme der letzte Einsatzort, nachdem
ihre Truppenteile gegen Kriegsende an der Front zerschlagen waren. Sie
ergänzten die gut ausgebildeten Flaksoldaten, die von Anfang an dienten.
Bei den Bomberverbänden waren die Türme wegen ihrer hohen Feuerkraft
gefürchtet. Jagdverbände der Luftwaffe zwangen die Bomberverbände in
die tiefer gelegenen Feuerbereiche der Flak, wo sie große Verluste
erlitten. Aus der Luft waren sie nahezu nicht angreifbar und auch
Zufallstreffer konnten nur bedingten Schaden anrichten.
|
 |
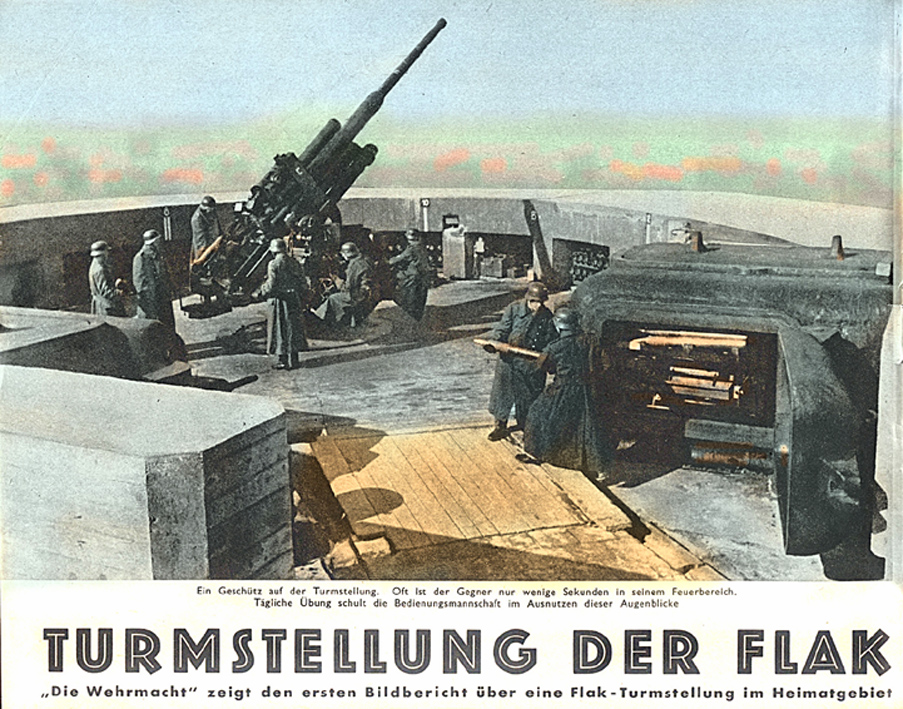 |
Aufnahmen:
Kriegsberichter Günther Pilz
|

Vom
Gefechtsstand aus, in dem alle Meldungen über den einfliegenden Feind
gesammelt werden, wird bei Übung und im Ernstfall der Einsatz der
gesamten Turmstellung geleitet. |
Am
Kanal und in Norwegen, im Heimatkriegsgebiet und in den besetzten Gebieten
zerschlägt die Flak- artillerie der Luftwaffe feindliche Bomber.
In
Feldstellungen und auf Turmstellungen sind leichte Geschütze mit
höchster Feuerkraft und weittragende Geschütze mit hoher Schußleistung
zur Abwehr aufgestellt. Beim Eintreffen der Flugmeldungen eilen die
Kanoniere im Geschwindschritt zu ihren Geschützen. In immerwährender
Ausbildung sind sie darauf geschult, die Sekunden, in denen der Gegner im
Feuerbereich der Batterie weilt, durch Abschüsse auszunutzen und den
Briten daran zu hindern, einen gezielten Bombenwurf durchzuführen.
Technik im Festungsbau, artilleristische Höchstkonstruktion und
bestausgebildete Kanoniere vereinigen sich so zum Abwehrkampf. 5645
Feindflugzeuge hat die Flakartillerie der Luftwaffe in 32 Kriegsmonaten
vom Himmel geholt.
Bild
rechts: Bei Alarm eilen die Flakkanoniere an ihren Gefechtsstand,
denn die Schnelligkeit ist entscheidend. |
 |
 |
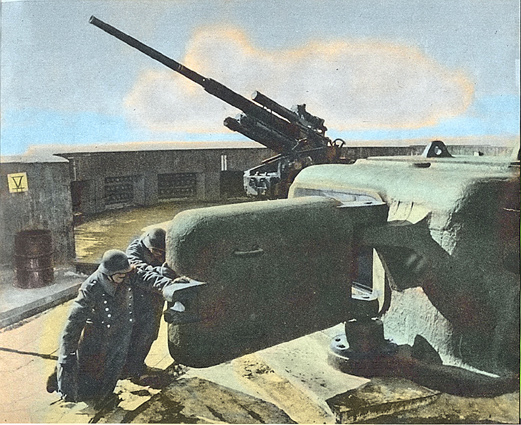
|
Bild
oben: Flakkanoniere tragen sie unter Panzerschutz lagernden Granaten zum
Munitionsaufzug, der sie zu den Geschützen oben auf dem Turm befördert.
Bild
oben rechts: Zwei Kanoniere benötigen ihre ganze Kraft, um die Panzertür des
Munitionsaufzuges in ihren Angeln zu drehen.
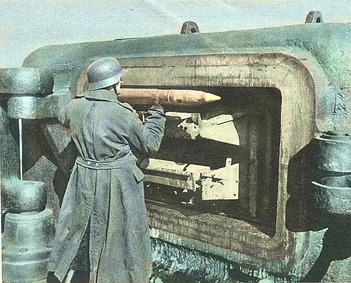 |
Bild
links:
Jeder
Griff - selbst das scheinbar so einfache Abheben der Grananten vom
Munitionsaufzug - gehört zur täglichen Übung.
Bild
rechts:
Nach
den Angaben des Entfernungsmessers richtet das Vierlingsgeschütz seine
Feuerkraft auf den in niedriger Höhe anfliegenden Feind. |
 |

|